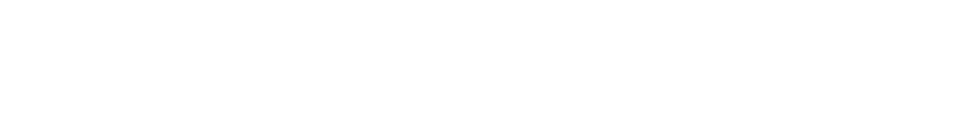Hemma V.
Auf einmal gab es nur noch Deutsch
Hemma V. wurde 1935 in Remschenig/Remšenik in Kärnten in eine slowenische Familie geboren. Die Großfamilie lebte von einer kleinen, gepachteten Landwirtschaft. Hemma V.s Vater wurde zur Deutschen Wehrmacht einberufen. Noch bevor er seinen Entschluss, sich beim nächsten Fronturlaub den Partisanen und Partisaninnen anzuschließen, in die Tat umsetzen konnte, fiel er im Krieg. Frau V.s Mutter war im Widerstand aktiv und unterstützte die Partisanen und Partisaninnen. Hemma V. musste schon als kleines Mädchen viele Demütigungen über sich ergehen lassen und schreckliche Dinge mit ansehen. In der Schule wurde sie physisch und psychisch misshandelt, die Familie wurde bespitzelt und mit Deportation bedroht. Diese Erlebnisse belasten Hemma V. bis heute in Form von Angstzuständen, Albträumen und depressiven Zuständen.
Ich bin in Remschenig geboren. Meine Eltern hatten eine kleine Wirtschaft gepachtet, und wir hatten zwei Kühe und zwei Schweine. Bei uns wohnten noch mein Opa, Oma, ein Bruder und eine Schwester. Zuhause sprachen wir nur slowenisch.
Als der Krieg begann, wurde der Vater zur Deutschen Wehrmacht einberufen. Wir haben ihn später nur noch einmal gesehen, als er auf Heimurlaub kam – danach ist er im Krieg gefallen.
1942 kam ich in die Volksschule nach Eisenkappel. Auf einmal gab es nur noch Deutsch. Die Lehrerin durfte kein Wort Slowenisch hören, ich aber konnte überhaupt nicht Deutsch. Es war schrecklich. Ich musste stundenlang in der Ecke knien. Da ich auf den Beinen starken Wundschorf hatte, hatte sich unter meinen Knien immer eine Blutlacke gebildet. Es hat höllisch weh getan. Wenn ich dann noch geweint habe, bekam ich noch Schläge mit dem Stock. Wie oft habe ich in die Hose gemacht – teils, weil ich nicht wusste, wie man auf Deutsch sagt, dass man aufs WC gehen muss, teils aus Angst. Ich hatte höllische Angst vor der Lehrerin und wollte überhaupt nicht mehr in die Schule gehen.
Oft wartete ich im Wald, bis der Vormittag vorbeiging. Natürlich hatte dies zur Folge, dass ich die Klasse wiederholen musste. Es gab aber auch oft Fliegeralarm. Das rettete mich dann vor der Strafe, denn wir mussten alle in den Keller.
1943 begann sich der Widerstand gegen Hitler zu regen. In Remschenig hörte man davon reden, und zwar sehr geheimnisvoll, jedoch bekamen wir selten einen Partisanen zu sehen. Eines Tages kamen drei oder vier "Partisanen" zu uns. Meine Mutter hat sie freudig empfangen und gab ihnen Milch, Brot und Sterz zu essen. Sie haben viel gefragt, und die Mutter hat ihnen ausführliche Antworten gegeben. Sie fragten auch, warum mein Vater nicht die Fronten wechsle. Meine Mutter erzählte ihnen, dass der Vater, sobald er Heimurlaub bekommen wird, sich ihnen freiwillig anschließen werde. Die "Partisanen" verabschiedeten sich, und niemand im Haus schöpfte Verdacht. Als ein wenig später meine Schwester in den Stall gehen wollte, sah sie hinter dem Gebäude die Polizei. Sie lief zurück ins Haus, und erst da begriff meine Mutter, dass uns nicht Partisanen, sondern verkleidete Deutsche besucht hatten. Opa und Oma begannen zu jammern, und wir hatten höllische Angst. Die Deutschen zogen sich zwar zurück, meine Mutter aber überlegte, was zu tun wäre. In der ersten Panik nahmen wir Decken und gingen in den Wald. Dort verbrachten wir die erste Nacht schlafend unter freiem Himmel. Meine Mutter beriet sich mit den Großeltern, und am nächsten Tag gingen die Großeltern mit uns Kindern zurück nach Hause, die Mutter aber ging zu den Partisanen, wo sie bis zum Kriegsende verblieb.
Nun kamen öfter die Deutschen vorbei und fragten nach unserer Mutter. Die Großeltern behaupteten, die Partisanen hätten sie mit Gewalt mitgenommen. Sie wollten auch mich und meine Schwester befragen. Auf den Tisch legten sie eine Schokolade und fragten uns, ob wir Partisanen und unsere Mutter gesehen hätten. Obwohl uns die Schokolade sehr reizte, sagten wir kein Wort, und auch die Schokolade nahmen wir nicht. Sie kamen immer öfter, oft blieben sie die ganze Nacht – sie brachten Stroh in die Küche und legten sich da nieder. Im Hof aber [stand] die Wache mit den Gewehren im Anschlag. Vergebens warteten sie auf meine Mutter und andere Partisanen. Nur wenn wir auf die Wäscheleine ein weißes Leintuch hängten, kamen die Partisanen vorbei, denn das hieß, dass die Luft rein war – dies war mit den Partisanen so besprochen. Wir hatten aber immer Angst, wenn fremde Partisanen kamen, da wir nie wussten, ob sie wohl nicht nur verkleidete wären. Diese Angst blieb bis zum Kriegsende.
Die Partisanen hatten in der Nähe unseres Hauses einen Bunker, und da waren immer drei Kuriere. Sie alle kamen immer wieder zu uns, und die Oma gab ihnen zu essen. Kurz vor dem Kriegsende wurde einer davon angeschossen, und er starb qualvoll 14 Tage später. Meine Schwester [brachte] ihm Tee und Nahrung, jedoch konnte er nicht essen, da er einen Bauchdurchschuss hatte. Einmal brachten die Partisanen einen Kollegen mit einem gebrochenen Bein. Die Nacht über schliefen sie bei uns auf der Tenne, und in der Früh brachten sie ihn zu einem Schuppen, zirka eine halbe Stunde Gehzeit von uns. Es war tiefer Winter. Nun musste ihm meine Schwester täglich Nahrung bringen, und das 14 Tage lang. Da dies sehr gefährlich war und damit kein Verdacht geschöpft wurde, musste ich sie einige Male begleiten. Dies war sehr mühsam, da viel Schnee auf dem Weg lag.
Als in Remschenig etwa 15 Familien ausgesiedelt wurden, kamen die Deutschen auch zu uns. Da meine Oma schwer krank im Bett lag, nahmen sie nur meinen betagten 80-jährigen Opa mit. Am nächsten Tag haben sie ihn wieder freigelassen – es war wie ein Wunder, und wir wissen noch heute nicht, was das bewirkt hatte.
Am schlimmsten aber war es, als die Deutschen eines Tages drei unserer Nachbarn zu uns brachten. Sie mussten an den Händen zusammengebunden eine Nacht auf der Tenne bei uns verbringen, bis sie am nächsten Tag nach Eisenkappel abgeführt wurden, und wir durften ihnen nicht helfen. Als meine Oma ihnen etwas zu essen geben wollte, sagte ein Deutscher: "Banditen brauchen kein Essen!" Es war schrecklich, wir haben alle geweint. Meine Oma befürchtete oft, dass auch wir eines Tages so abgeführt werden.
Ich werde nie vergessen, als die Deutschen einen Partisanen in der Nähe unseres Hauses im Bachgraben erschossen haben. Ich ging über die Brücke und sah im Wasser einen blonden Mann liegen. Er lag da ausgestreckt am Rücken, mit Blut überströmt. Noch immer sehe ich dieses Bild ganz genau vor mir, wie könnte ich es jemals vergessen. Natürlich habe ich mich auch zutiefst erschrocken.
Als im Mai der Krieg offiziell zu Ende war, da kamen noch immer Horden von Ustascha [1] über die Grenze. Wir fürchteten uns sehr vor ihnen, da sie oft wahllos durch die Gegend schossen. Mein Onkel (der Bruder meiner Mutter), der zuerst an der deutschen Front war, danach zu den Partisanen ging und gegen Ende des Krieges von den Deutschen festgenommen wurde, hat den Krieg überlebt, wurde jedoch von den Ustascha zuhause auf der Alm erschossen. Was haben wir alle geweint.
Die Erstveröffentlichung dieses Artikels erfolgte in: Renate S. Meissner im Auftrag des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus (Hg.): Erinnerungen. Lebensgeschichten von Opfern des Nationalsozialismus. Wien, 2010, Seite 223-225.
[1] Mit dem Deutschen Reich kollaborierende kroatische faschistische Bewegung.