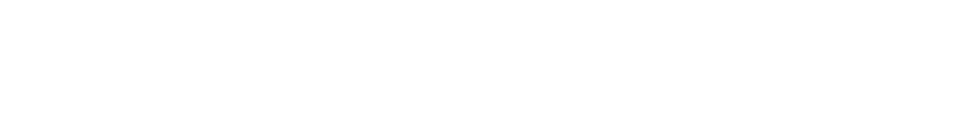Leo Luster
Jetzt fangt unser Unglück an
Leo Luster wurde 1927 in Wien geboren. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich verlor sein Vater Moshe Luster seine Arbeit; die Wohnung der Familie wurde beschlagnahmt. Im September 1942 wurden Leo Luster und seine Eltern in das Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt in Böhmen deportiert. 1944 kamen er und sein Vater in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, wo sein Vater ermordet wurde. Nachdem er zum „Arbeitseinsatz“ in das KZ Gleiwitz transportiert worden war, wurde Leo Luster im Jänner 1945 auf einen so genannten Todesmarsch geschickt. Er wurde im KZ Blechhammer von der sowjetischen Roten Armee befreit.
1949 emigrierte Leo Luster mit seiner Mutter Golda Luster, die Theresienstadt überlebt hatte, nach Israel. Dort lernte er seine Frau Shoshana kennen, die er 1955 heiratete.
Nach seiner Pensionierung im Jahr 1992 setzte sich Leo Luster gemeinsam mit dem ebenfalls aus Österreich stammenden Gideon Eckhaus für die in Israel lebenden, vertriebenen österreichischen Jüdinnen und Juden ein und war Vorstandsmitglied des Zentralkomitees der Juden aus Österreich in Israel und der Vereinigung der Pensionisten aus Österreich in Israel. 2002 erhielt er für seine Tätigkeiten in diesen Funktionen das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich.
Leo Luster ist Mitte Jänner 2017 in Israel verstorben.
2010 hatte Tanja Eckstein vom Verein Centropa („Zentrum zur Erforschung und Dokumentation jüdischen Lebens in Ost- und Mitteleuropa“) mit Leo Luster in Israel ein ausführliches lebensgeschichtliches Interview geführt (siehe unter http://www.centropa.org/de/biography/leo-luster). Der Nationalfonds bedankt sich bei Tanja Eckstein und Centropa für die Möglichkeit, Ausschnitte daraus veröffentlichen zu dürfen. Beim hier publizierten Text handelt es sich um eine vom Nationalfonds redigierte Fassung.
Nach dem Anschluss 1938
Ich erinnere mich wie heute. Der 11. März 1938 war ein Freitag. Ich war mit meinem Vater am Abend in der Synagoge. Auf dem Weg von der Synagoge nach Hause hielt uns ein Nachbar auf: „Herr Luster, kommen Sie herein. Es ist etwas Schreckliches passiert.“ „Was ist passiert?“ Der Schuschnigg [1] ist zurückgetreten.“
Als mein Vater erfuhr, dass der österreichische Bundeskanzler zurückgetreten ist, war ihm klar, jetzt fängt unser Unglück an. Ich erinnere mich noch genau an seine Worte: „Jetzt fangt unser Unglück an.“ Und so war es! Schuschnigg ist zurückgetreten, und am Samstag sind schon auf der Straße die Leute mit den Hakenkreuzbinden herumgelaufen und man hat schon die Juden gesucht. Gleich an dem Samstag!
Mein Vater hat sofort nach Einmarsch der Deutschen seine Arbeit verloren. Die Juden haben bald verstanden, hier können wir nicht bleiben, wir müssen hier raus. Aber das war damals ein großes Problem. Die Deutschen haben sofort alle Regierungsfunktionen mit ihren Leuten besetzt, das ging sehr, sehr schnell. Auch die Polizei haben sie übernommen. Sie haben genau gewusst, wer wo wohnt, wer reich ist und wer arm ist. Sie haben die Juden eingekreist und ihnen alles weggenommen. Es hat keine jüdischen Geschäfte mehr gegeben, alles war aus. Mein Vater wollte nach Amerika auswandern. Er hat geglaubt, dass der Bruder meiner Mutter uns helfen wird [2], aber das war nicht so. Zum Glück bekam er einen Posten als Ordner bei der Fürsorge in der Kultusgemeinde [3]. Somit war er für Soziales mitverantwortlich, denn die Kultusgemeinde hat, soweit es ihr möglich war, die Juden unterstützt.
Mein Freund Edi Tennenbaum wohnte uns genau gegenüber. Er konnte 1939 mit einem Kindertransport [4] nach England flüchten. Seine Eltern waren aus Riga. Ich habe nie wieder etwas von Edi gehört. Ich hatte noch einen Freund, das war der Julius Nussbaum, Bubi haben wir ihn genannt. Sein Vater hatte ein Schneidergeschäft in der Miesbachgasse im 2. Bezirk. Wir waren zusammen in der JUAL-Schule [5]. […] Mein Freund Bubi wurde 1943 vom Ghetto Theresienstadt ins KZ Auschwitz deportiert und ermordet. […]
Am 10. November 1938, nach der Pogromnacht, der so genannten „Kristallnacht“ [6], wurde mein Vater verhaftet und eingesperrt. Unsere Wohnung war im dritten Stock. In dem Haus, in dem wir wohnten, gab es auch eine Kellerwohnung ohne Licht, ohne Strom und Wasser und ohne eine Toilette. Das war eine Ein-Zimmer-Wohnung mit einer kleinen Küchenecke. In dieser Wohnung wohnte ein Mann, ein illegaler Nazi [7]. Er kam zu uns in die Wohnung rauf und hat gesagt, dass wir die Wohnung räumen müssen. Er hat uns aus unserer Wohnung rausgeschmissen. Als er kam, waren nur meine Schwester und ich zu Hause. Wir mussten unsere Sachen aus der Wohnung nehmen, die, die wir tragen konnten, und in die Kellerwohnung gehen. Er ist einfach raufgegangen und hat uns unsere Wohnung weggenommen. Und wir haben dann dort gewohnt. Wir hatten dort nur eine Petroleumlampe, und das Wasser mussten wir vom Gang holen. Ich glaube, mein Onkel Benjamin war es, der mir einmal einen Fotoapparat geschenkt hat. Ich habe gern und viel fotografiert, so auch meine Eltern im Lichthof vor dieser Wohnung.
Als mein Vater freigekommen ist, wurde es dann ein biss’l leichter für uns. Er war ganz zerschlagen, er hat erzählt, warum. Die hatten ihm gesagt, er darf mit niemandem darüber reden, was er erlebt hat. Man hatte die Leute dort gequält und geschlagen.
[…] Wir haben ungefähr eineinhalb Jahre in dieser Kellerwohnung gewohnt. Mein Vater ist wieder zu seiner Arbeit in die Kultusgemeinde gegangen. Als die Deportationen begannen, ist es meinem Vater gelungen, eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Floßgasse für uns zu bekommen. Das letzte Jahr in Wien mussten wir nicht mehr in der Kellerwohnung leben. Meine Schwester war zu dieser Zeit bereits weggefahren. Mein Vater hatte 1940 durch die Kultusgemeinde die Möglichkeit, sie in einem der illegalen Transporte nach Palästina [8] unterzubringen. Man musste dafür Geld bezahlen, die Leute mussten sich einkaufen. Im Herbst 1940 ist sie weg von Wien. Sie brauchte einen Pass und ein Visum. Dann ist sie nach Bratislava gefahren. In Bratislava lernte sie ihren tschechischen Mann, Israel Mayerowicz, einen Tischler, kennen. Sie haben noch in Bratislava geheiratet. Für die Heirat musste meine Schwester die Bewilligung meines Vaters bekommen, denn sie war noch keine 18 Jahre alt. Das Schiff ist dann nach einiger Zeit von Bratislava über Rumänien nach Palästina gefahren. Das war eine schreckliche Odyssee, bis sie nach vielen Wochen den Hafen von Haifa [9] erreichten, das Schiff in einem entsetzlichen Zustand. Die Passagiere wurden aufgefordert auf das Schiff „Patria“, das neben ihnen im Hafen lag, umzusteigen. Die „Patria“ wurde wenig später von der Hagana [10] […] im Hafen gesprengt, damit die Flüchtlinge von den Engländern nicht weiter nach Mauritius geschickt werden konnten. Eigentlich sollte nur das Schiff beschädigt werden, aber viele Geflüchtete starben dabei. [11] Meine Schwester hat zum Glück überlebt. Sie haben drei Töchter bekommen, Ruth, Ora und Pessy. Israel starb 1988, meine Schwester starb 2009 in Hadera [12]. Die Töchter leben alle drei in Israel. […]
Als meine Schwester schon nicht mehr in Wien war, hatte ich mit ihren Freundinnen, die in Wien geblieben waren, noch Kontakt. Alle diese Freundinnen sind nach Polen deportiert und ermordet worden.
Meine Mutter war eine Selfmadefrau. Sie hat immer, in jeder Situation, „ihren Mann“ gestanden. Auch später im Lager war das so. Sie hat sich immer auf ihre eigenen Füße stellen können. Sie konnte auch aus fast nichts ein Essen zaubern.
Im Jahre 1940, es gab nur noch den Wiener Stadttempel, die anderen waren alle zerstört worden, hat mein Vater aus der Umgebung zehn Leute zusammengerufen, das ist ein Minjan [13], und man hat mir in der Wohnung, in der wir gewohnt haben, eine Bar Mitzwa [14] gemacht.
Ich bin ab 1940 in zwei Schulen gegangen, in die Sperlgasse und am Nachmittag in die JUAL-Schule, die Jugendvorbereitungsschule für Palästina, in der Marc-Aurel-Straße 5. Als ich in der Sperlgasse 1941 die letzte Klasse beendet hatte, hat man aus der Schule ein Deportationslager gemacht. [15] Ich war 14 Jahre alt und in der 8. Klasse.
In der Zeit, als wir jüdischen Kinder überhaupt nicht mehr in die Schule gehen durften, [16] hatten wir in der JUAL-Schule verschiedene Professoren. Hauptsächlich haben wir über Zionismus [17] gelernt. Ich habe damals viel gelesen, auch politische Bücher. Die Bücher habe ich in der Schulbibliothek ausgeliehen. Viele Bücher von Sholem Asch [18] waren dabei. Sholem Asch stammte aus Polen. Es gibt in Tel Aviv ein Sholem-Asch-Haus.
Bis zu unserer Deportation ging ich in diese Schule. Die Schule war mein Glück damals, ich war in Sicherheit, hatte Gesellschaft und war gut aufgehoben. Einige meiner Freunde damals waren Kurt Weigel, Berthold Mandel, Harry Linser, Berisch Müller, Walter Teich, Ehrlich, seine Vornamen habe ich vergessen, Kurt Salzer, Tasso Engelberg, Georg Gottesmann, Ernst Vulkan, Heinz Beer, Kurt Herzka, Kurt Weinwurm, Trude Schneider, Thea Gottesmann, Gerti Melzer und Shalom Berger. Mit denen war ich sonntags auch auf dem Zentralfriedhof, am 4. Tor. Dort durften wir Ball spielen, picknicken und uns ohne Einschränkungen wie normale Jugendliche benehmen. [19]
Mein Glück war, dass mein Vater in der Kultusgemeinde gearbeitet hat, denn dadurch waren wir irgendwie geschützt und wurden nicht nach Polen deportiert, sondern nach Theresienstadt. Viele, die in der Kultusgemeinde gearbeitet haben, sind 1942 nach Theresienstadt deportiert worden. Wir wussten, dass es das Ghetto in Theresienstadt gab, aber was sich dort abspielte, haben wir nicht gewusst. Gehört hatten wir über die KZs Dachau [20] und Buchenwald [21], denn es gab Leute, die dort waren, gleich ab März 1938, und einige mit einem Permit oder einem Affidavit [22] wurden entlassen. Dadurch haben wir etwas erfahren.
Ungefähr 100.000 Juden aus Österreich gelang die Flucht ins Ausland. Die Leute standen Schlange vor dem ehemaligen Palais Rothschild in der Prinz-Eugen-Straße, denn da hatte Eichmann [23] von 1938 bis 1942 sein Büro, die „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ [24], eingerichtet. Dort saß die Gestapo [25]. Wenn jemand auswandern wollte, musste er von dort einen Stempel haben, um überhaupt aus Österreich rauszukommen. Und man brauchte einen Pass, den viele Leute damals nicht besaßen. Da musste man sich bei der Polizei anstellen, um einen Pass zu bekommen. Dann musste man zur Steuerbehörde, um eine Bestätigung zu bekommen, dass man keine Steuerschulden hat. Dann musste man eine Reichsfluchtsteuer bezahlen, sonst hat man keinen Stempel bekommen. Schikanen über Schikanen! Wenn man einen Pass bekommen hatte, lief man von einem Konsulat zum anderen, um ein Visum zu bekommen. Man hat versucht, als Butler, als Gärtner, als Hausmädchen nach England zu kommen. Nach Italien sind einige illegal geflüchtet, andere sind über Aachen nach Belgien geflüchtet und weiter nach Holland. Manche bekamen eine Einreise in die USA. Dann begannen Ende 1939 Kindertransporte nach England. Es ging die ganze Zeit nur darum, irgendwie rauszukommen! Man hat alles Mögliche versucht. Es gab auch Kindertransporte nach Palästina, an die man mit einem Zertifikat oder auch mit Protektion kam. Es war sehr, sehr schrecklich.
Mein Vater hat alles versucht, um mich rauszubringen aus Österreich. Er hatte kein Glück. Er hat es nicht geschafft, mich irgendwo unterzubringen. Ich hatte keine Möglichkeit rauszukommen. Alexander Lauer, dem Sohn meiner Tante Hilda, der Schwester meiner Mutter, hat er helfen können, nach England zu flüchten. Alexander war ein Jahr älter als ich. Die Familie war sehr fromm, und er kam in einem Transport der Agudat Jisra’el, das sind ganz Fromme, [26] nach England unter. Seine Mutter Hilda starb 1937 an Krebs, die Urne seines Vaters Naftali Lauer wurde uns 1942 aus dem KZ Buchenwald geschickt. 1939 war er verhaftet und nach Buchenwald deportiert worden. Wir mussten für die Urne bezahlen und haben ihn dann am Zentralfriedhof, am 4. Tor, begraben.
Wenn ich ehrlich bin, ich wollte auch nicht wegfahren. Ich wollte meine Eltern nicht allein lassen. Ich bin in dieser Zeit ziemlich schnell erwachsen geworden. Ich habe gesehen, was sich abspielt, und ich war damals auch sehr viel unter erwachsenen Menschen, sodass ich bald erfasst habe, was um mich herum passiert. In den Wohnungen saßen die Leute zusammen und haben über alle möglichen Sachen diskutiert. In die Wohnung ist man gegangen, weil man Angst hatte, irgendwo anders zu sitzen. Die Kaffeehäuser waren verboten, die Kinos waren verboten, die Theater waren verboten, überall hat gestanden „Juden ist der Eintritt verboten“. Wir durften auch in keine Parkanlage mehr gehen, auf Bänke durften wir uns nicht mehr setzen und mit der Straßenbahn durften wir auch nicht mehr fahren.
Ab 1940, als ich die Schule beendet hatte, musste ich mich auf dem Arbeitsamt melden, habe ein Arbeitsbuch bekommen, und dann musste ich in einer Fabrik auf der Rossauer Lände arbeiten, die für die Wehrmacht produzierte. Ich besitze das Arbeitsbuch noch heute. Das war eine chemische Fabrik. Der Besitzer der Fabrik hieß Weinzierl. Und da habe ich mir eingebildet, der wird mir helfen, dass wir nicht deportiert werden. Aber der hätt’ mir nicht geholfen. Geholfen hat nur, dass mein Vater in der Kultusgemeinde gearbeitet hat. Das war unser Glück.
Es waren immer weniger Juden in Wien. Wien wurde „judenrein“ gemacht. Die Transporte gingen nach Łódź in Polen, Riga in Lettland, Kaunas in Litauen, Minsk in Weißrussland und Theresienstadt in der Tschechoslowakei und an andere Orte, wo sie ermordet wurden. 45.000 Jüdinnen und Juden wurden innerhalb weniger Monate aus Wien deportiert. Als wir weg mussten, waren nur noch wenige Juden in Wien. Die Übriggebliebenen waren Mischlinge [27], und ein paar, die früher hohe Posten in der österreichischen Armee hatten, die haben sie nicht verschickt. Aber später haben sie die auch verschickt.
Wir sind am 24. September 1942 aus dem Sammellager in der Sperlgasse 2a, einer ehemaligen jüdischen Schule, auf offenen Lastautos, zu denen wir unter den Beschimpfungen der Leute hingeführt wurden, zum Aspangbahnhof [28] gebracht worden. Wir wurden noch mit Tomaten beworfen, und die Wiener riefen: „Raus mit euch Juden!“ Das war die Zeit, als Deutschland die meisten Siege feierte. Frankreich hatten sie auch schon besetzt. Ich weiß noch, ich war sehr traurig über den Hass der Leute. Was mich erwartete, habe ich nicht gewusst. Ich wusste, ich will weg von Wien, und ich wusste, in Theresienstadt sind Juden. Dort sind Juden, was sein wird, wird sein.
Wir sind mit dem Zug zwei Tage gefahren. In diesem Transport aus Wien befanden sich ungefähr 1.300 Menschen.
Dann kamen wir in Bauschowitz [29] an. Der Bahnhof lag drei Kilometer von Theresienstadt entfernt. Wir mussten zu Fuß mit unseren Sachen ins Ghetto gehen.
Theresienstadt ist eine Stadt, eine Festung, die während der Regierungszeit von Kaiser Joseph II. ab 1780 erbaut wurde. Das war eine Garnisonsstadt, in der die Familien der Soldaten gelebt hatten. In der Festung gab es viele Kasernen.
Alles war umgeben mit zwei Mauern, dazwischen war ein Graben mit Wasser gefüllt. Die Mauern waren je acht bis zehn Meter dick und auch so hoch. Sie bestanden aus gebrannten Ziegeln. Das Ghetto wurde von tschechischer Gendarmerie bewacht unter der Obhut der SS [30] und von Juden selbst verwaltet. Als ich im Ghetto war, habe ich drei Lagerführer erlebt, alle drei waren Österreicher: SS-Hauptsturmführer Siegfried Seidl [31], SS-Obersturmführer Anton Burger [32] und SS-Obersturmführer Karl Rahm [33]. […]
Das Ghetto in Theresienstadt mussten tschechische Juden 1941 errichten. Und sie waren dort auch die Herren. Sie hatten dort die Macht. Sie hatten die guten Posten, wir waren die Neueinwanderer sozusagen, uns hat man auf die ärgsten Plätze geschickt.
Die meisten tschechischen Juden, nicht alle, aber ein großer Teil von denen, hat Deutsch gesprochen. Die anderen waren tschechische Patrioten, die wollten nicht Deutsch sprechen. Auch mit uns wollten sie nicht Deutsch sprechen.
Als wir ankamen, haben die tschechischen Juden uns im Auftrag der SS erst einmal alles weggenommen, was wir noch besaßen. Jeder hatte 40 Kilo mitnehmen dürfen. Ich hatte einen Rucksack und einen Koffer. Da war eine große Schleuse, wo man die Sachen hingebracht hat. Sie haben alles ausgepackt und für die Leute, die dort waren, verwendet.
[…] Die SS-Leute hatten im Zentrum ein Büro, und außerhalb haben sie in einer Villa oder in einem Hotel gewohnt. Sie sind jeden Tag mit dem Auto ins Büro gefahren. Die tschechischen Juden hatten Kontakt zu den Gendarmen. Es waren einige sehr anständige Gendarmen dabei, sie haben manchmal Nachrichten oder Sachen überbracht und haben geholfen. Man hätte nicht ausbrechen können, die Gendarmerie hat aufgepasst. Die Tschechen hätten vielleicht eher geholfen als die Österreicher, aber sie hatten natürlich auch Angst. Die meisten SS-Männer dort waren Österreicher. SS-Männer waren es vielleicht acht.
Zu dieser Zeit befanden sich zwischen vierzigtausend und fünfzigtausend Leute im Ghetto. Man brachte damals noch viele Menschen aus Österreich, aus Deutschland und später aus Holland, aus Westerbork [34]. Viel später kamen die Juden aus der Slowakei. Aber die meisten waren aus Deutschland. Als ich in Theresienstadt war, war der Judenälteste der Tscheche Jakob Edelstein [35]. Unser Wiener Lehrer Aron Menczer [36] kannte Edelstein aus der Hitlerzeit, denn er war damals oft in Prag und hatte einen guten Kontakt zu ihm. Er kannte mehrere Leute aus Prag. Aron kam mit demselben Transport wie meine Eltern und ich und ungefähr zwanzig meiner Freunde aus Wien. Dank Aron haben wir eine Gruppe mit zionistischen Jugendlichen gegründet. Wir haben auch durch ihn einen besseren Platz bekommen in Theresienstadt, wo wir zusammen gewohnt haben. Das hat alles der Aron für uns erledigt. Wir haben uns Betten gebaut, wir haben dort’n ein biss’l Kulturarbeit gemacht, man hat uns Hebräisch gelehrt, wir hatten Professoren, die Vorträge hielten, es gab Musiker, die Konzerte gaben, es gab Theateraufführungen, alles konnte man machen. Es gab sogar eine Synagoge.
Wir hatten viel Freizeit, die SS-Männer haben sich überhaupt nicht gekümmert. Sie haben nur eines gemacht: Ab September, als wir nach Theresienstadt gebracht wurden, begannen die großen Transporte in den Osten. Es gab einen Zusammenhang zwischen diesen Transporten und der Offensive der Russen. Die Schlacht um Stalingrad hatte begonnen! Die Russen begannen sich dem Deutschen Reich zu nähern. Da haben sie angefangen, die Menschen auf die Transporte in die Vernichtungslager zu schicken.
Niemand hat gewusst, wohin die Transporte gehen. Wir haben nur gewusst, es geht nach dem Osten. Aber wohin die gehen, das wussten wir nicht. Es sind manchmal schreckliche Nachrichten durchgesickert, aber wir haben das nicht geglaubt. Dass wir vernichtet werden in Auschwitz, haben wir nicht gewusst. Wir haben gedacht, dass wir in Arbeitslager kommen. Aber viele wurden zum Beispiel nach Minsk [37] gebracht, dort hat man sie auf der Straße erschossen. Es ist niemand zurückgekommen von denen. Aber wir haben nichts gewusst. Manchmal haben wir sogar Nachrichten, Postkarten bekommen. Man hat sich Codes ausgemacht. Wenn man das und das schreibt, bedeutet das das und das. Und deswegen hat man etwas vermutet über Dinge, die dort passieren. Aber Auschwitz? Die Wahrheit, was sich dort abspielt, haben wir nicht gewusst. Aber wir hatten Angst.
Zuerst haben meine Eltern und ich zusammen gewohnt, das war auf einem Dachboden. Es war schrecklich. Wir haben nichts gehabt. Aber meine Mutter hat auch daraus was gemacht. Mein Vater hat dann in der Sudetenkaserne gewohnt, und meine Mutter hat einen anderen Platz mit anderen Frauen zusammen bekommen. Aber sie konnten sich jeden Tag treffen.
Ich hab durch Aron eine gute, aber schwere Arbeit in der Küche beim Essenstransport bekommen. Ich habe also Essen ausgeteilt. Das war schwer, aber ein großer Vorteil. Jeder hatte eine Essenskarte für den Tag, in der Früh gab es ein biss’l schwarzen Kaffee und ein Stück’l Brot, zu Mittag eine Suppe oder was anderes, und am Abend haben wir auch etwas bekommen. In der Küche hatte ich Essen genug, so konnte ich meine Karte meinen Eltern zu ihren Karten dazugeben. Ich habe viel Essen gestohlen, Kartoffeln und alles Mögliche, und habe alles meiner Mutter gebracht. Sie hat dann gekocht – wir haben nicht gehungert. Aber für die Leute, die nur ihre Essenskarte gehabt haben, war es sehr schwer. Jeder hatte an seinem Gürtel einen großen Esslöffel. Wenn wir ein Fass ausgeschöpft hatten und das Fass noch dastand, sind die deutschen Juden gekommen mit ihren Löffeln und haben die Fässer ausgekratzt. So hungrig sind sie gewesen. Das war schrecklich!
Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass wir Jungen dort auf Kosten der Alten am Leben geblieben sind. Das, was wir gestohlen haben, haben wir ihnen gestohlen. Es sind auch sehr viele Menschen in Theresienstadt an Hunger und Krankheiten, wie Typhus [38] zum Beispiel, gestorben.
Viele konnten sich schwer an die schrecklichen Umstände anpassen. Zum Beispiel: Die Betten waren Stockbetten, und da schliefen zwei unten und zwei oder drei oben. Die, die oben geschlafen haben, hatten es am besten, weil man sich oben etwas aufbauen konnte, zum Beispiel sich einen Tisch bauen. Und Verheiratete haben sich ab und zu oben getroffen. Es waren dort Situationen, die kann man sich nicht vorstellen.
Man konnte in Theresienstadt überleben. Aber trotz meiner guten Situation bekam auch ich verschiedene Krankheiten, Typhus zum Beispiel. Es gab wunderbare Ärzte aus Prag. Meine Mutter hatte ein Myom [gutartiger Tumor], da wurde sie von einem Arzt, einer der größten Koryphäen aus Prag, operiert. Normalerweise wäre sie nie zu einem Arzt gekommen, der so hervorragend war.
Mein Vater hat beim Straßenbau gearbeitet. Ich habe ihm immer Essen gebracht. Mein Vater hat geraucht und sein Essen manchmal für ein paar Zigaretten verkauft. Meine Mutter war immer böse, wenn er Zigaretten gekauft hat. Aber was kann man machen?
Unsere Jugendgruppe hat sehr zusammengehalten. Von unserer Gruppe kamen vier junge Burschen vor uns anderen mit einem Straftransport nach Auschwitz. Später habe ich erfahren, was mit ihnen passiert ist. Alle wurden in Birkenau ermordet.
Ich war bis September 1944 in Theresienstadt. Vierzehn Transporte sind weggefahren, Frauen, Männer, alle jungen Leute, unsere ganze Gruppe, die zusammen gewohnt hatte. Wir waren alle in demselben Transport nach Auschwitz. Mein Vater war auch dabei. Was mit meiner Mutter war, habe ich nicht gewusst. Während der zwei Jahre, die ich in Theresienstadt war, waren die Schienen von den jüdischen Zwangsarbeitern von Bauschowitz nach Theresienstadt verlängert worden. Die Züge kamen direkt in die Stadt herein. Man hat uns von Theresienstadt nach Auschwitz geschickt.
Wir sollten am Jom Kippur [39], das war der 27. September, wegfahren. Aber die Lokomotive ist kaputt gegangen, da hat man uns gelassen. Ich erinnere mich noch heute, ich bin dann mit meinem Vater in die Synagoge gegangen. Wir haben gebetet, danach gefastet, und am nächsten Tag mussten wir uns zum Transport melden.
Am 28. September mussten wir in die Waggons, und dann, am Abend, sind wir weggefahren. Es wurde Nacht, und wir haben nicht gewusst, wohin wir fahren. Das waren Viehwaggons, in denen man nur so ein kleines Fenster hat. Wir haben beobachtet, wohin wir fahren, welche Richtung. Anhand der Richtung haben wir gesehen, wohin wir fahren. Wir fuhren nach Osten. Ich erinnere mich, wir sind ziemlich langsam durch Dresden gefahren. Ich habe ein wenig von der Stadt gesehen. Wir sind durchgefahren und immer weiter, bis wir nach Schlesien [40] kamen, durch Breslau [41] fuhren und in die Nähe von Krakau [42] kamen. Zwei Tage und eine Nacht sind wir gefahren.
Plötzlich, es war in der Nacht, hörten wir Schreie. Der Zug fuhr langsam durch ein Tor und blieb stehen. Die Waggontüren wurden aufgerissen, Häftlinge schrien: „Raus, raus, raus!“ Wir waren ungefähr tausend Menschen auf diesem Transport. Es war dunkel, aber ringsherum waren Lichter, Stacheldraht, Beton, Pfosten. Auf dem Stacheldraht waren Schilder, auf denen stand „Hochspannung!“ Wir verstanden, dass alles mit Hochspannung geschützt war. Die meisten von den Häftlingen, die uns anschrien, waren polnische Juden. Meine Uhr haben sie mir sofort weggenommen: „Gib her die Uhr, die brauchst du sowieso nicht mehr.“ Alles, was ich damals noch besaß, haben sie mir weggenommen. Nicht nur mir, allen haben sie alles weggenommen. Wir haben nicht gewusst, was uns geschieht. Wir wurden auf eine Rampe getrieben. Es roch komisch. Was riecht da? Irgendwas Verbranntes, wir wussten nicht, was das ist.
Auf der Rampe mussten wir uns in Fünferreihen aufstellen, der ganze Transport, die tausend Menschen in Fünferreihen. Vorn stand eine Gruppe von vier, fünf SS-Männern mit Hunden. An denen musste jeder vorbeigehen, und jeder wurde was gefragt. Ich habe gesehen, der SS-Mann zeigt auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Die älteren Leute gingen auf die linke Seite, die jüngeren Leute auf die rechte Seite.
Man konnte glauben, die linke Seite war für die Leute, die für die leichtere Arbeit bestimmt sind, und die auf der rechten Seite, das sind die, die die schweren Arbeiten machen müssen. Oft haben sich Leute älter gemacht, damit sie leichtere Arbeit bekommen, anstatt sich auf die rechte Seite zu stellen. Zum Beispiel der Vater von meinem Freund war Apotheker. Der SS-Mann hat gesagt: Was bist du von Beruf? Apotheker. Brauchen wir nicht, linke Seite. Hätte er gesagt, er war nämlich noch jung, er sei Schlosser oder so was Ähnliches, wäre er vielleicht am Leben geblieben. So war das.
Als ich dran war, hat mich ein SS-Mann gefragt, wie alt ich bin, was für einen Beruf ich habe. Elektriker, habe ich gesagt. Und ich musste auf die rechte Seite. Das waren die Fragen der SS-Leute. Wir haben nicht verstanden, was da überhaupt passiert.
Und da mache ich diesen Juden, die mit uns als erste zusammengetroffen sind, als wir aus den Waggons mussten, den Vorwurf, dass sie uns nicht davor gewarnt haben, was dort passiert. Die anderen Häftlinge haben uns nicht geholfen, nichts gesagt, jeder war nur für sich. Die haben nicht gesagt: „Hört zu, dort ist eine Selektion, macht’s euch jünger, sagt das oder das.“ Sie haben uns nicht gesagt, was da passiert. Die wollten nur unseren Besitz: „Hast einen Goldring, hast eine Uhr?“ – Alles, was sie wollten, haben sie uns weggenommen. Das war schrecklich!
Ich habe nicht gewusst, wo mein Vater ist. Ich hatte ihn aus den Augen verloren. Ein paar Stunden später habe ich das Krematorium und das Feuer gesehen. Wir begannen, mit den anderen Häftlingen zu sprechen. Wir haben sie gefragt, wohin man die Leute gebracht hat, die von der Rampe weggeführt wurden. Da hat einer zu mir gesagt: „Siehst du dort den Schornstein und den Rauch? Dort sind sie schon rausgeraucht.“ Ich war entsetzt! Aber ich habe es glauben müssen. Ich habe den Rauch gesehen mit meinen eignen Augen. Und ich habe es gerochen.
Die geblieben sind, hat man nachher in das KZ Birkenau gebracht, in das Zigeunerlager [43]. Es standen dort viele große Baracken. Am ersten Tag wurden uns außer den Schuhen und dem Gürtel alle Kleider weggenommen. Und dann mussten wir duschen. Wir haben nicht gewusst, dass man dort, wo wir geduscht haben, unsere Eltern vergast hatte. Diesmal ist statt Gas Wasser aus den Duschen gekommen. [44]
Nach dem Duschen haben wir Sträflingskleider bekommen. Die waren sehr dünn, und zu der Zeit war es kalt in Polen, sehr, sehr kalt. Wir haben schrecklich gefroren.
Die Baracken waren früher Pferdeställe der polnischen Armee. In jeder Baracke war in der Mitte ein Kamin, und auf der Seite sind die Pferde gestanden. Dort hatte man statt der Pferde Stockbetten aufgestellt. Es gab einen Blockältesten, der war für alles verantwortlich. Das waren manchmal Kriminelle, Verbrecher [45]. Manches Mal hatte man Glück, dann war der Blockälteste ein Sozialist. Viele Kapos [46] waren Verbrecher. Die haben uns auch nur alles wegnehmen wollen, was wir noch gehabt haben. Vom Essen haben sie uns nur ein wenig gegeben, das andere haben sie selbst genommen.
In der Früh mussten wir zum Appell antreten, wurden gezählt, am Abend mussten wir wieder antreten, wurden wieder gezählt und oft geschlagen.
Als wir in die Baracke gekommen sind, haben wir unsere Schuhe ausziehen müssen und zu je fünf Paar hintereinander aufstellen. In der Früh waren alle Schuhe weg, kein Schuh war mehr da. Man muss sich das mal vorstellen, es lag Schnee, und wir hatten keine Schuhe mehr. Einer hat dem anderen die Schuh gestohlen. Ohne Schuhe, wenn man krank wurde, war man gleich erledigt. Birkenau war schrecklich! Ich hab sehr schnell begriffen, dass man dort nicht bleiben darf, das war kein Platz, um zu überleben. Häftlinge haben uns zu verstehen gegeben, dass man, um in Birkenau überhaupt zu überleben, eine eintätowierte Nummer haben muss. Wenn du keine Nummer hattest, warst du nichts wert. [47] Du warst Freiwild, sie konnten mit dir machen, was sie wollten. Ich habe begriffen, dass ich rauskommen muss. Wenn man in Birkenau bleibt, ist man Futter für die Krematorien.
Die polnischen Juden haben Jiddisch gesprochen. Ich habe genau zugehört und verstanden, es werden SS-Männer kommen, die suchen Fachleute. Meine Freunde und ich haben zusammengehalten, und dann kam wirklich ein SS-Mann und suchte Schlosser. Wir haben uns alle gemeldet. Das erste Mal wurden wir nicht genommen, aber beim zweiten Mal ist es uns gelungen. Wir waren sechs Freunde, und wir wurden alle für die Arbeit ausgesucht. Man hat uns bessere Kleidung gegeben, und wir bekamen eine Nummer in den Arm tätowiert. Das hieß, wir waren Menschen. Wir bekamen Decken, wurden zum Zug gebracht, und wir fuhren von Birkenau nach Gleiwitz [Gliwice, Polen]. Das war nach drei schrecklichen Wochen.
Meine Freunde Otto Kalwo, Heinz Beer, Kurt Herzka, Georg Gottesmann, Ernst Vulkan und ich blieben zusammen. Wir haben fest zusammengehalten. Damals war Gleiwitz eine deutsche Stadt, heute liegt Gleiwitz in Polen. Gleiwitz war eine große Stadt und lag ungefähr fünfzig Kilometer von Auschwitz entfernt. Dort gab es vier Nebenlager vom KZ Auschwitz. Die Wachmannschaften in dem KZ waren aus Rumänien, deutschstämmige Siebenbürger. Die waren noch schlimmer als die Deutschen, schreckliche Leute waren das. Man hat uns in eine Fabrik, in der Eisenbahnwaggons repariert wurden, gebracht. Ein riesiges Werk war das! In großen Hallen standen ungefähr zehn Waggons, einer hinter dem anderen. Vielleicht zwanzig Gleise gab es da. Die Waggons waren beschädigt, und wir mussten sie reparieren. Uns wurde gezeigt, was wir machen müssen. Wir haben die Nieten aufschneiden müssen. Mit Schweißapparaten haben wir das gemacht. Es war eine wirklich schwere Arbeit den ganzen Tag. Ich war kein Schlosser, aber ich habe schnell gelernt. Kalt war es, das kann man sich nicht vorstellen. Jedes Eisenteil war sehr schwer und kalt. Wir haben in zwei Schichten gearbeitet, einmal am Tag und einmal in der Nacht. Essen haben wir bekommen, und duschen konnten wir uns auch. Aber es war schwer, und es war nicht geheizt. Es waren viele Menschen in der Baracke, darum war es etwas wärmer. Jeder musste mal rausgehen, da musste man sich abmelden, dann wurde aufgepasst, dass man nicht wegläuft. Sechs Tage in der Woche haben wir gearbeitet, und am siebenten Tag haben wir nicht gearbeitet. Und da haben sie uns am siebenten Tag, damit wir beschäftigt sind, zum Appell antreten lassen. Wir mussten dann Steine, die auf einem Platz einen Kilometer vom Lager entfernt lagen, auf einen Platz ins Lager tragen und dann dieselben Steine zurücktragen. Nur damit wir nicht ausruhen können.
Während meiner Schweißarbeiten hatte ich aus Eisen so eine Art Topf hergestellt. Viele andere Häftlinge, die bei den Waggons gearbeitet haben, brachten mir deshalb […] Kartoffeln, Kraut und alles Mögliche, was sie in den Waggons gefunden hatten. Wir waren doch keine Tiere: Kartoffeln kann man doch nicht roh essen, wir mussten sie kochen. Da haben sie mir die Kartoffeln gebracht, und ich hab mit dem Schweißapparat die Kartoffeln gekocht und habe dann auch etwas abbekommen. Dieses Essen hat mich ein biss’l über Wasser gehalten. In den Waggons haben wir auch manchmal ein paar Zeitungsausschnitte gefunden. Da konnten wir lesen, dass die Russen vor Warschau standen. Aber ganz genau haben wir das nicht gewusst … Und auf einmal bekamen wir den Befehl, wir gehen nicht zur Arbeit. Jeder bekam ein halbes Brot, eine Konserve mit Blutwurst, ein Stückchen Margarine und Marmelade. Blutwurst ist nicht koscher. Die darf man nicht essen. [48]
Wir mussten losmarschieren. Das war ein Todesmarsch. SS-Männer haben uns die ganze Zeit begleitet. Das waren schon ältere Leute von der Waffen-SS, Soldaten, die nicht mehr an der Front eingesetzt wurden. Manche der Bewacher waren anständig, manche nicht. Es war sehr kalt, es war noch immer Winter. Wir hatten keine warmen Kleider und schlechte Schuhe. Wir sind gegangen, gegangen, gegangen ... Wohin? Das haben wir nicht gewusst. Wir gingen den ganzen Tag, viele Kilometer. Unterwegs konnten sehr viele nicht mehr. Diese Leute wurden einfach erschossen. Wer zurückgeblieben ist, wurde erschossen. Wir sind drei Tage zu Fuß gegangen. Essen haben wir nicht bekommen, in der Nacht hat man uns irgendwo in ein Lager gebracht, da sind wir vor Müdigkeit sofort eingeschlafen. Kalt war uns, einer ist auf dem anderen gelegen. So haben wir geschlafen, einer hat den anderen gewärmt.
Am Ende des Todesmarsches kamen wir nach Blechhammer [Blachownia Śląska, Polen]. In Blechhammer war ein riesengroßes Hydrierwerk, wo die Deutschen aus Kohle Benzin und künstliches Gummi erzeugt haben. Dort arbeiteten viele Kriegsgefangene. Aber es gab in Blechhammer auch ein großes KZ. Das war ein Außenlager des KZ Auschwitz. In diesem Lager waren unter anderem Franzosen, Jugoslawen, amerikanische Piloten, Engländer, sogar aus Palästina war dort eine Gruppe britischer Soldaten, die in Kreta in Gefangenschaft geraten waren. Einer der bekanntesten von denen war Josef Almogi [49], der spätere Führer der Histadrut [50] in Haifa. Uns hat man ins KZ gebracht. Das heißt, man hat uns über Nacht hingebracht. Ich erinnere mich an einen großen Appellplatz und ungefähr zwanzig Baracken. Das war schon Anfang Februar 1945. Es war furchtbar kalt, ein sehr kalter Winter. Dort fand ich eine englische Armeeuniform, die ich anzog. Die Wolle der britischen Uniformen war unglaublich warm. Man hat uns in eine Baracke gebracht, und das war unser Glück, in der Kisten mit Sodawasser-Flaschen standen. Wir hatten nicht allzu viel Platz. Meine Freunde aus Wien und ich waren zusammengeblieben. Die anderen sind in anderen Baracken untergekommen. Wir sind todmüde eingeschlafen. Und dann, in der Früh, hat es wieder geheißen: Aufstehen und zum Appellplatz. Man musste sich immer aufstellen, um sich abzählen zu lassen.
Wir haben unter uns ausgemacht, dass wir uns nicht auf dem Appellplatz aufstellen, denn wir hatten mitbekommen, was sich dort tat. Die Leute, die nicht gehen konnten, die müde waren, wurden erschossen. Warum sollten wir uns dort erschießen lassen? Wir gingen nicht aus unserer Baracke. Ob man erschossen wird draußen oder hier, in der Baracke, da ist es besser hier. Warum sollten wir uns unterwegs noch plagen? Draußen wurde geschrien, raus, raus zum Appell. Wir sind nicht gegangen, wir haben uns nicht gemeldet, wir haben uns in der Baracke versteckt. Aber die SS-Männer haben gemerkt, dass sich viele Leute versteckt haben, dass sie nicht rausgehen. Was haben die gemacht? Sie haben begonnen, die Baracken anzuzünden.
Sie haben brennende Fackeln auf die Dächer geworfen, und die Baracken begannen zu brennen. Die Leute haben nicht atmen können und sind rausgelaufen. Wer rausgelaufen ist, wurde wie die Hasen abgeschossen. Wenn einer Glück gehabt hat, hat er es bis zum Appellplatz geschafft. Wenn nicht, ist er am Weg erschossen worden und liegen geblieben. Wir sind nicht rausgegangen. Unsere Baracke begann auch zu brennen. Die Sodawasser-Flaschen haben uns gerettet. Wir haben das Sodawasser auf das Feuer gegossen; die ganze Zeit, und wir haben überlebt.
Den ganzen Tag haben sie dort Leute erschossen, dann sind sie weg. Die haben scheinbar Angst bekommen. Die Leute, die sich am Appellplatz gemeldet haben, hat man, das habe ich später erfahren, zu Zügen am Bahnhof gebracht und sie in einem Waggon nach Groß-Rosen [51] geschickt. Es waren mit uns dann noch einige Leute, die sich, wie wir, im Lager versteckt hatten. Viele waren verletzt und sind daran gestorben, weil sie keine Hilfe hatten. Wir haben uns zwei Tage dort aufgehalten. Wir hatten nichts zu essen, wir waren hungrig. Aber wir haben uns nicht rausgetraut, wir blieben in der Baracke. Draußen war es ruhig.
Dann, am dritten Tag, haben wir langsam die Tür aufgemacht und haben rausgeschaut. Wir konnten das Tor sehen, durch das wir reingegangen waren. Das Tor stand offen, und auf den Wachtürmen waren keine SS-Männer. Ich bin aus der Baracke rausgegangen, auch andere sind rausgegangen. Da waren Leute, die schon längere Zeit in dem KZ waren. Sie haben gesagt, in welcher Baracke man was zu essen finden könne. Wir sind alle dort’n hingelaufen und haben die Baracke aufgebrochen. Es gab Brot, und ich habe so viel Brot genommen, wie ich tragen konnte. Auf einmal, ich wollte mit dem Brot gerade aus der Baracke, stand draußen ein SS-Mann mit einer Maschinenpistole, der die Leute abknallte. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Es bildete sich ein Menschenhaufen. Alle lagen aufeinander, da hab ich mich einfach dazugeworfen. Mit dem Brot habe ich mich raufgeworfen. Ich bin gelegen, und der hat geschossen. Auf einmal hat er aufgehört zu schießen. Er hatte keine Kugeln mehr, hat Angst bekommen, denn wir waren doch viele, er war nur einer. Daraufhin ist er weggelaufen. Langsam habe ich mich aus dem Menschenhaufen rausgegraben. Einige waren tot oder verletzt.
Ich habe das Brot genommen und es meinen Freunden gebracht. So hatten wir was zu essen. Es war ganz still. Meine Freunde und ich hatten nun Brot und Wasser. Nach ein paar Tagen waren der Otto Kalwo und ich schon ein biss’l bei Kräften, und wir wollten wissen, wo wir sind. Wir verließen das Lager. Die anderen, Heinz Beer, Kurt Herzka, Georg Gottesmann und Ernst Vulkan, blieben in der Baracke. Sie waren zu schwach, um mit uns zu kommen.
Das Lager war umgeben von einem ganz großen und dunklen Wald. Man hat kaum etwas gesehen, weil es so dunkel war. Wir gingen eine Straße, die durch den Wald führte, entlang. Plötzlich hörten wir von Weitem Motorengeräusch. Wir glaubten, die SS kommt zurück, und sind in den Wald reingelaufen. Wir kamen zu einer Anhöhe. Von der Straße aus konnte man uns nicht sehen, denn es war wirklich sehr dunkel. Wir sahen, dass sich ganz langsam eine Autokolonne näherte. Ich sagte zu meinem Freund: „Hör zu, diese Autos schauen nicht so aus wie die Autos von den Deutschen. Die sind etwas anders.“ Wir waren uns aber nicht sicher. Die kamen immer näher, und wir sahen dann deutlich, das waren keine deutschen Autos. Das waren, später habe ich das erfahren, amerikanische Lastautos. Die russische Armee hatte diese Autos von den Amerikanern bekommen. Jetzt haben wir verstanden, denn wir haben gesehen, auf der Motorhaube war ein großer roter Stern; ein Sowjetstern [52]. Das waren Russen! Wir stellten uns mit erhobenen Händen auf die Straße. Das erste Auto blieb stehen. Ein Soldat mit Pelzmütze stieg aus. Das war das erste Mal, dass ich einen Russen gesehen habe. Er trug eine Pelzmütze mit einem Sowjetstern.
Ich habe gesehen, dass auch er Angst hatte. Ich wusste nicht, was ich sagen soll, da habe ich gesagt „Jid, ja. Jid, Jid.“ (Jude, ja. Jude, Jude.) Er schaute uns an und sagte: „Ja tosche Jid.“ (Ich bin auch Jude.) Es hat sich herausgestellt, das war ein jüdischer Offizier, und der hat jiddisch gesprochen. Viele der russischen Offiziere waren Juden, man konnte sie als Dolmetscher einsetzen. Also haben wir mit ihm reden können. Wir haben ihm gesagt, dass da ein Lager ist. Seine Kompanie hat dann das ganze Lager besetzt und übernommen. Die Russen waren sehr anständig, sie haben alle nach und nach rausgeführt und betreut. Wir blieben noch zwei Tage dort. Wir bekamen Essen, und der Offizier sagte uns, dass nahe des Lagers eine kleine Siedlung sei. Dort hatten die deutschen Ingenieure, die in dem großen Werk in Blechhammer gearbeitet hatten, gewohnt. Der Ort war ungefähr einen Kilometer vom Lager entfernt. Meine Freunde und ich gingen dorthin und haben uns einfach in eine Villa reingesetzt. Alles gab es da, denn die Deutschen hatten alles stehen gelassen und waren weggelaufen. Im Keller waren Lebensmittel gelagert: Eingelegtes Fleisch, Gemüse und Obst, alles war da, nur Brot haben sie nicht gehabt, und es gab kein Wasser und kein Geschirr. Wir sind von einem Haus zum anderen gegangen und haben uns Geschirr geholt. Das, was schmutzig war, haben wir rausgeworfen aus dem Fenster. Das war richtig wertvolles Porzellan, aber wir hatten keinen Bezug zu dem allen mehr. Wasser hatten wir, indem wir Schnee aufgetaut haben. Manche unserer Freunde haben Durchfall bekommen, das war gefährlich.
Wir blieben drei Wochen in dieser Villa. Hatten dort, wie man sagt, ein meschuggenes [hebräisch/jiddisch: verrücktes] Leben. Der Offizier kam uns wirklich öfter besuchen. Und eines Tages kam er zu uns und sagte: Freunde, ihr müsst’s von da weggehen, ihr könnt’s nicht bleiben, weil wir Angst haben, dass die Deutschen eine Gegenoffensive starten, und ihr könntet wieder in ihre Hände geraten. Geht’s in Richtung Osten, weiter nach Polen rein. Und wir gingen los: Er war der Kommandant.
Wir luden alle möglichen Sachen, die wir hatten, auf ein Wagerl und schleppten außerdem noch Sachen so mit. Einer von uns, der Georg Gottesmann, war krank. Er hatte die Ruhr [53]. Wir haben ihn in einem Wagerl geschoben, weil er nicht gehen konnte. Das war alles sehr schwer, aber wir sind sehr viele Kilometer wieder zurück in Richtung Osten gegangen. Teilweise sind wir gegangen, und teilweise konnten wir die Bahn benützen. Die Russen hatten die Schienen verbreitert, damit die russischen Lokomotiven darauf fahren konnten. Bis nach Posen [54] haben sie die Schienen umgebaut. Wir haben schnell gelernt, wie man den Lokomotivführer fragt, wohin er fährt. Und da sind wir mitgefahren und teilweise zu Fuß gegangen. In Oberschlesien [55] waren noch Deutsche, in Gleiwitz zum Beispiel. Die hatten vor uns unheimliche Angst. Wir haben ihnen alles weggenommen, wir haben sie aus den Wohnungen rausgeschmissen, die sollten uns bedienen. Dann waren wir in Kattowitz [56], und danach sind wir mit einem Zug bis nach Krakau gekommen. In Polen musste man alles mit Geld bezahlen, sie haben uns nichts umsonst gegeben. Man musste für alle Sachen bezahlen. Aber woher hätten wir Geld haben sollen? Wir haben einige Sachen verkauft: eine Jacke, einen Hut usw. Dafür haben wir Geld bekommen. In Krakau war dann ein jüdisches Komitee, das war in der Dluga-Straße Nummer 38. Vom Komitee haben wir Ausweise vom Roten Kreuz bekommen, aber ansonsten haben sie uns nicht viel helfen können, sie haben selber nichts gehabt. Wir haben uns mit einigen Juden aus Polen befreundet. Die Russen waren sehr misstrauisch und die Polen auch, sie hätten denken können, wir sind deutsche Soldaten, die weggelaufen sind. So haben wir immer Leute gehabt, die bezeugen konnten, dass wir Juden sind, und uns dadurch geschützt haben. Wir haben nur ein paar Worte Polnisch verstanden, aber das war nicht genug, um sich zu verständigen. Wir blieben immer in der Nähe unserer neuen Freunde, damit sie für uns reden konnten. Eine Zeit lang blieben wir in Krakau.
Die russische Armee hatte so eine Art Sammellager eingerichtet, dort konnten wir schlafen, und man hat uns zu essen gegeben. Wir hatten nichts mehr, alle unsere Sachen, auch unsere Kleidung, hatten wir verkauft. Essen und schlafen können war schon genug für uns, das war schon etwas! Aus dem Lager konnten wir die Stadt Krakau besichtigen, und wir waren das erste Mal nach dem Krieg im Kino.
Die Russen sind dann immer weiter vormarschiert, über die Oder [57], nach Deutschland hinein. Das war schon im März. Anfang April haben die Russen uns gesagt, dass sie ein Lager in der Nähe von Sagan [Żagań, Polen], das ist nicht weit von der Oder, errichtet haben. Im Februar 1945 hatten sie diese Stadt in Niederschlesien [58], die zwischen Cottbus [59] und Breslau liegt, eingenommen.
Wir wurden mit der Bahn nach Sagan gebracht. Dort war auch ein großes DP-artiges [60] Lager. Da waren schon Jugoslawen, Franzosen und Menschen aus allen möglichen Ländern. Dort konnten wir schlafen und essen. Wir hatten ja keine Kleidung, aber ein Freund war ein guter Schneider. Wir haben dort eine schöne Nähmaschine und Ballen von Stoff gefunden. Aber unser Freund hatte nur eine Nadel für die Nähmaschine, und die eine Nadel ist zerbrochen, und so konnte er nicht nähen. Was haben wir gemacht? Wir sind in die Stadt gegangen und haben in der ganzen Stadt eine Nadel für die Nähmaschine gesucht. Ich weiß nicht, was wir alles zerbrochen haben, um eine Nadel zu finden. Aber zum Schluss haben wir eine gefunden. Nicht nur eine, wir haben ein ganzes Paket gefunden. Auch dort waren die Deutschen weggelaufen und hatten alles zurück gelassen: die Häuser, die Wohnungen, die Geschäfte, die Fabriken. Die Russen haben es ganz einfach gemacht: Wenn sie eine Fabrik gefunden haben, haben sie die Wände umgelegt und alles, auch die Maschinen, mitgenommen. Bei den Wohnungen haben sie einfach die Fenster herausgenommen. Sie haben alles genommen und nach Russland gebracht. Und das, was die Russen gemacht haben, haben wir auch gemacht. Wir haben alles genommen, was wir konnten. Aus den Stoffballen hat unser Freund Unterhosen für uns genäht, wir hatten ja keine. Jeder hatte dann eine Menge Unterhosen. Und Leiberln hat er uns auch genäht von dem Stoff. Die Zeit ist vergangen, den ganzen April und den Mai waren wir in Sagan.
Dort gab es auch Zigeuner. Wir hatten nicht viel zu tun, und da haben wir uns von denen die Zukunft voraussagen lassen. Ich erinnere mich noch genau, die Zigeunerin sagte zu mir: „Du hast eine Mutter!“ Ich sagte: „Ja, eine Mutter habe ich gehabt.“ Sie sagte: „Du hast eine Mutter!“ Sie sagte auch verschiedene andere Sachen, und noch zwei Freunden sagte sie: „Du hast eine Mutter.“ Wir haben das nicht geglaubt, wir wussten, das kann nicht sein.
Nach dem Krieg
Die Zeit verging, es kam der 8. Mai [1945], der Krieg war zu Ende. Die Russen kamen zu uns und sagten: „Der Krieg ist zu Ende, geht, wohin ihr wollt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seid frei, richtig frei!“
Was haben wir uns gesagt? Wir sind nicht weit entfernt von Berlin, wir wollen nach Berlin fahren. Wir suchten uns einen Zug, der nach Berlin fährt. Was will der Zufall? Man brachte uns zu einer Bahn, die uns nach Cottbus fuhr. In Cottbus war ein schöner großer Bahnhof, die Russen hatten die Schienen mit der breiten Spur bis Cottbus gelegt. Die Züge sind nur bis Cottbus gefahren. Dort hatten sie erst begonnen, die Schienen bis Berlin zu legen. Wir suchten nach einer Möglichkeit, nach Berlin zu kommen. Auf einmal sahen wir auf dem Bahnhof einen jungen Menschen mit einer Armbinde, auf der stand „KZ Theresienstadt“. Meine Freunde und ich waren sicher, dass das KZ Theresienstadt aufgelöst worden war, dass sie alle mit den Zügen in die Vernichtungslager weggeschickt hatten. Zu hundert Prozent waren wir sicher. Wir gingen zu dem jungen Mann und fragten: „Theresienstadt, gibt es Menschen dort?“ Er erzählte uns, dass von allen möglichen Lagern viele Leute nach Theresienstadt gebracht worden waren. Es wären tausende Menschen in Theresienstadt. Als wir das hörten, haben wir uns gesagt, statt nach Berlin fahren wir nach Theresienstadt. Und das haben wir gemacht.
Wir sind dann von Cottbus mit einem Zug nach Dresden [61] gefahren. Wir wollten von der Grenzstation Bodenbach nach Bauschowitz. Bauschowitz war die Bahnstation von Theresienstadt. Wir haben den Schaffner überzeugen können, uns ohne Geld mitzunehmen, denn Geld hatten wir ja keins. In Bauschowitz sind wir aus dem Zug gestiegen. Als alte Theresienstädter kannten wir den Weg zu Fuß, das waren drei Kilometer. So waren wir damals aus Wien angekommen. Wir sind also von Bauschowitz zu Fuß die drei Kilometer nach Theresienstadt zur Festung raufgegangen. Wir standen nicht unter Zwang, wir kamen freiwillig! Sigi Ritberg konnte noch nicht gehen, da haben wir das Wagerl gehabt, und wir haben ihn geschleppt.
Stopp, die tschechische Gendarmerie wollte uns nicht reinlassen. Das Lager stand unter Quarantäne, im Lager war Typhus. Wir versuchten sie zu überzeugen, dass sie uns reinlassen. Am Ende fanden wir einen Kompromiss: Wir gehen rein, aber nicht mehr raus. Unter dieser Bedingung hat man uns reingelassen. Wir kamen auf der Hauptstraße Theresienstadts rein. Dort traf ich einen älteren Herrn. Was will das Schicksal? Dieser ältere Herr war ein Freund meines Vaters. Er hatte mit ihm in der Kultusgemeinde zusammengearbeitet, und er war mit mir in Gleiwitz. Sein Beruf war Frisör. Frisör war ein guter Job, im KZ mussten wir immer geschnittene Haare haben. Ich hatte ihn in Gleiwitz gesehen. Er schaute mich an, ich schaute ihn an und sagte: „Wie kommst du daher?“ Er sagte: „Du lebst?“ Er erzählte kurz seine Geschichte: Er war auch in Blechhammer, musste dann aber weiter nach Groß-Rosen. Von dort hatte man ihn dann ins KZ Buchenwald gebracht, und von Buchenwald ist er nach Theresienstadt gebracht worden. Ich hab ihm erzählt, dass wir in Polen waren, dass wir schon eine ganze Weltreise hinter uns hatten. Dann sagte er zu mir: „Du warst schon bei deiner Mutter?“ Ich schaute ihn an. „Wo, wo ist meine Mutter?“ Er sagte: „Ich hab sie gesehen, sie ist hier!“ Ich sagte: „Das kann doch nicht sein?“ „Du kannst mir glauben, ich habe deine Mutter hier in Theresienstadt gesehen.“ Er wusste nicht, wo sie wohnte, aber er sagte, dass ich sie bestimmt finden werde, er hatte sie gesehen.
Ich wusste, wo ich mich erkundigen konnte. Ich habe gefragt, wo meine Mutter wohnt. Da hat man mir die Adresse gegeben, und sie hat wirklich da gewohnt. Sie wohnte auf einem Dachboden mit einer Freundin, einer Wienerin, mit deren Sohn ich befreundet war und der im Lager umgekommen war.
Ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, wie das damals war. Ich bin auf den Dachboden gestiegen zu meiner Mutter, und sie sah mich. Kann man sich das vorstellen? Na gut, die erste Frage, die sie gefragt hat: „Wo ist der Papa?“ Ich konnte nichts sagen, und da hat sie nur gesagt: „Gott hat mir beschert, dass du am Leben geblieben bist.“ Sie hat dann gesagt, man hätte ihr erzählt, und sie wollte das nicht glauben, dass man mich in Krakau gesehen hatte. Das war so: Georg Gottesmann, einer unserer Freunde, war sehr krank geworden. Als wir nach Krakau kamen, hatte Georg Fieber. Wie sich herausstellte, hatte er eine schwere Tuberkulose [62]. Da haben wir Folgendes gemacht: Wir brachten ihn in ein Spital und sind dann weggelaufen. Am nächsten Tag sind wir ihn im Spital suchen gegangen. Dort, im Spital, traf ich einen Tschechen, der war ein Madrich [63] in Theresienstadt. Er war auch Patient. Von ihm erfuhren wir, dass man unseren Freund im Spital aufgenommen hatte. So war diese Nachricht zu meiner Mutter gekommen, aber sie konnte nicht glauben, dass ich am Leben war.
Später ist unser Freund Georg nach Gauting, einen Vorort von München, verlegt worden. Dort war ein Lungensanatorium. Und was wollte der Zufall? Wir erfuhren davon und haben ihn dann gleich besucht und ihm natürlich viel geholfen. Unser Freund im Spital hatte nichts, nur die Kleider, die er nach der Befreiung in Polen getragen hatte. Ich hab ihn mit Kleidung versorgt, das war damals für uns schon leicht. Alles, was möglich war, haben wir ihm besorgt.
Erfahren hat man damals alles durch Mundpropaganda, das ist sehr schnell gegangen, und dann wurde auch alles in einer Lagerzeitung veröffentlicht. Später in Deggendorf [64] haben wir eine Zeitung herausgegeben. Einer unserer Freunde war sogar ein Redakteur der Zeitung. So wussten wir sehr viel. So hat Georg auch die Nachricht bekommen, dass seine Mutter und seine Schwester den Krieg überlebt hatten. Aber sie waren nicht in Wien, sie waren irgendwo in Ungarn.
Neben Georg lag ein älterer Herr. Die Frau dieses älteren Herrn war meine Cousine. Sie ist immer ihren Mann besuchen gekommen. Sie hat den Georg oft allein gesehen, da hat sie ihn gefragt, woher er kommt. Georg hat ihr seine ganze Geschichte erzählt. Sie sagte ihm dann, sie habe einen Cousin in Wien gehabt, kenne ihn nicht, aber er müsste in Georgs Alter sein. Dann fragte sie ihn, ob er zufällig einen Leo Luster kenne. „Was für eine Frage“, sagte Georg, „ich bin mit ihm aufgewachsen.“ Meine Cousine hat durch ihn meine Adresse in Deggendorf bekommen. Sie war eine Tochter der Schwester meiner Mutter. Jahrelang hatten sie in Berlin gelebt, 1934 oder 1935 wurden sie als Polen aus Berlin nach Polen ausgewiesen. Ich kannte sie nicht, aber meine Mutter hat sie gekannt. Meine Cousine hat sich sehr gefreut, dass meine Mutter am Leben ist, denn sie waren die einzigen der Schwestern, die am Leben geblieben waren.
Die Freundin meiner Mutter, Frau Ehrlich, mit der sie in Theresienstadt am Dachboden gewohnt hat, hat mich dann gefragt, was mit ihrem Sohn Emil sei. Ich habe gesagt, dass ich es nicht wisse. Ich habe genau gewusst, dass er nicht mehr am Leben ist, aber ich habe es ihr nicht sagen können. Das hab ich nicht übers Herz gebracht.
Meine Mutter und ich haben dann eine Wohnung bekommen, und meine Mutter hat begonnen, mich zu versorgen. Sie war überglücklich, dass ich da war. Ich hatte inzwischen aber schon eine große Lebenserfahrung und viel miterlebt.
Zu der Zeit, als wir aus Theresienstadt nach Auschwitz gebracht worden waren, war Benjamin Murmelstein [65] der letzte Judenälteste im Ghetto Theresienstadt. Innerhalb der jüdischen Selbstverwaltung in Theresienstadt war er ab dem Moment der wichtigste Mann. Robert Prochnik [66], auch ein Wiener Jude, war sein Stellvertreter. Als wir nach Ende des Krieges nach Theresienstadt kamen, war der Murmelstein nicht mehr da, aber Prochnik war da. Die Russen hatten einen Kommunisten als Lagerchef eingesetzt. Ein gewisser Vogl [67], glaube ich, war das. Der Prochnik hatte etwas Angst vor uns, denn viele Dinge, die damals in Theresienstadt gelaufen sind, sind bis heute schwierig einzuschätzen […]. Jedenfalls hatte er Angst vor uns und hat uns wirklich bei vielen Dingen geholfen. Er hat uns eine Wohnung gegeben, in der wir wohnen und schlafen konnten. Essen hat uns nicht gefehlt. Dann wurden Sudetendeutsche [68] nach Theresienstadt gebracht, die putzen mussten. Wir haben auf sie aufpassen müssen. Ich habe sie ganz schön schikaniert, diese Deutschen. Die meisten Sudetendeutschen waren für Hitler, deshalb habe ich mich an ihnen gerächt.
In Krakau war ich mit ein paar österreichischen Kommunisten zusammen, die im KZ Auschwitz gewesen waren. Sie sind nach Wien zurückgefahren. In Wien wurde eine neue Regierung aufgestellt. Der Sozialdemokrat Karl Renner [69] war ab 1945 bis zu seinem Tod 1950 Bundespräsident. Ich wollte nicht zurück nach Österreich. Aber meine Mutter hatte vor unserer Deportation einer christlichen Frau eine schwere Goldkette mit einer Uhr und anderen Schmuck anvertraut und hoffte, die Uhr und den Schmuck zurückzubekommen, da wir überhaupt nichts mehr besaßen. Daraufhin beschlossen meine Freunde und ich, nach Wien zu fahren. Das war aber zu dieser Zeit fast unmöglich, weil man nicht einfach über die Grenze fahren konnte. Die einzige Möglichkeit, hatte man uns gesagt, sei, mit dem Zug von Prag nach Bratislava zu fahren, und von dort komme man vielleicht über die Pontonbrücke [auch Schiffbrücke oder Schwimmbrücke] [70]. Die Russen hatten diese Brücke gebaut, nach Hainburg und von Hainburg nach Wien.
Wir sind dann wirklich nach Prag gefahren und von Prag nach Bratislava. Dort gingen wir zum jüdischen Komitee; Hilfe beim jüdischen Komitee zu erbitten hatte ich in Krakau gelernt. Wir kamen zum jüdischen Komitee und sagten: „Wir sind Wiener und wollen nach Wien, wie kommt man da hin?“ Sie sagten, dass ein paar Russen unten bei der Brücke Wache stehen. Wenn man ihnen Wodka gibt, dann kann man rüberkommen. Sie haben Wodka für uns organisiert. Wir sind zu den Russen gegangen, haben ihnen den Wodka gegeben, und wir durften auf einem Lastwagen die Brücke passieren. Die Brücke hat schrecklich gewackelt, und die Donau hatte eine ordentliche Strömung. Noch dazu, der meschuggene […] Soldat. Aber wir sind rübergekommen und waren in Österreich, in Hainburg.
Wir waren sechs, der Walter Fantl (der war der Einzige der Gruppe, der dann in Wien geblieben ist), Siegfried Ritberg, Heinz Beer, Oskar Weiss, Kurt Herzka und ich und zwei ältere Männer, die russisch gesprochen haben, einer, weil er in russischer Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg war. Die waren unsere Dolmetscher.
Wir sind dann mit einem russischen Lastauto nach Wien getrampt, wie man so sagt. Unser Chauffeur war ein biss’l besoffen, und hinter uns fuhr ein russischer Offizier, und der wollte an ihm vorbeifahren, er hat ihn aber nicht gelassen. Als es ihm gelungen ist vorbeizufahren, hat er sich die Nummer des Lastautos aufgeschrieben. Wir kamen nach Schwechat, und da war eine Straßensperre beim Zentralfriedhof. Dort hat der Offizier unseren Chauffeur gleich rausgeholt aus dem Auto. Dabei hat er uns gesehen und festgestellt, dass wir keine Bewilligung für die russische Zone [71] hatten. Wir haben gesagt, dass wir keine Bewilligung brauchen, denn wir kennen uns in Wien sehr gut aus. Die Straßensperre war vor dem 4. Tor des Wiener Zentralfriedhofs. Wir gingen die Mauer vom Friedhof entlang, stiegen dann über die Mauer und gingen über den Friedhof auf die andere Seite. Und schon waren wir in Wien. An den Schienen der Tramway wurde bereits gearbeitet, wir konnten in die Stadt fahren.
Rückkehr nach Wien
Wien war schrecklich zerstört. Aber ich hatte ein angenehmes Gefühl dabei, dass man Wien zerstört hatte. Die Menschen sind herumgegangen, haben in den zerbombten Häusern Holz gesucht zum Heizen, weil sie keine Kohlen hatten, Wasser haben sie von den Hydranten geholt. Nichts hat mehr funktioniert.
Am Deutschmeisterplatz war das Büro der Kultusgemeinde. Wir sind dorthin gegangen, und die Leute dort sagten, dass wir ihnen helfen könnten, die Kultusgemeinde wieder aufzubauen.
Ich bin dann zu der Familie der Frau gegangen, der meine Mutter den Schmuck anvertraut hatte. Und was haben die gesagt? Die Russen hätten ihnen alles weggenommen. Aber ich habe mir nichts daraus gemacht.
Dann bin ich in das Haus in der Schreygasse gegangen, in dem wir gewohnt hatten. Ich wusste, die Hausbesorgerin hatte ein doppeltes Spiel gespielt – einmal war sie für uns, einmal gegen uns. Aber mein Vater hatte ihr alle unsere Möbel gegeben. Wir durften doch nichts verkaufen. Er hatte ihr alles geschenkt. Ich wollte sie besuchen, vielleicht war sie noch am Leben, und ging in das Haus.
Die sei nicht mehr da, die Hausbesorgerin, sagte der neue Hausbesorger. Und wer war der neue Hausbesorger? Es war der Kreisobmann der NSDAP. Er hatte mich immer zum Schneeschaufeln und zu anderen minderwertigen Arbeiten geholt. Nun trug ich die britische Uniform, ohne hohe Rangabzeichen, denn ich besaß ja nur diese Uniform und keine eigenen Kleider, und es war doch kalt in Wien! Die Österreicher hatten Angst und großen Respekt vor den Uniformen der Alliierten. Ich kam sozusagen als englischer Soldat in das Haus, in dem ich bis zu meinem 14. Lebensjahr gewohnt hatte. Inzwischen war ich natürlich älter geworden. Der Hausmeister hatte ein Fenster, durch das er sehen konnte, wer ins Haus reingeht. Ich habe ihn sofort erkannt, aber er mich nicht. Er schaute mich an und zitterte vor der Uniform. „Sie kennen mich nicht?“, fragte ich ihn. „Ich bin der Luster.“ „Ja, so, Sie leben noch!“ Durchs Fenster des Hausmeisters sah ich das Schlafzimmer meiner Eltern. „Sie wissen, wem das gehört?“, fragte ich ihn. „Das hat meinem Vater gehört.“ „Ihr Vater hat mir das alles geschenkt.“ „Das stimmt doch gar nicht“, sagte ich, „die Möbel haben Sie der Hausbesorgerin weggenommen, mein Vater hat sie der Frau Schlicksbir geschenkt, aber nicht Ihnen.“
Auf einmal kamen alle Leute aus dem Haus. Es hatte sich herumgesprochen, dass ein englischer Soldat im Haus ist. Dann ging ich in den 3. Stock zu dem Herrn, der uns die Wohnung weggenommen hatte. „Packen Sie Ihre Sachen, in zwei Stunden verlassen Sie die Wohnung. Sie ziehen in die Kellerwohnung.“
Ehrlich gesagt, ich wollte nicht dort, nicht in Wien sein. In Krakau hatte ich einen russischen Jungen kennengelernt, der für den NKWD [72] gearbeitet hat. Grischa hat er geheißen, er sprach sehr gut Deutsch. Grischa wollte aus mir einen Kommunisten machen. „Komm nach Russland, du wirst studieren, du wirst alles haben!“ Was wollte der Zufall? Ich traf diesen Grischa in Wien. Er saß im Augarten, dort war das Büro des NKWD, dort habe ich ihn getroffen. Wir haben uns über das Wiedersehen sehr gefreut.
„Kann ich dir helfen?“, fragte er mich. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht in Wien bleiben werde. Dann habe ich ihm aber die Geschichte vom Hausbesorger und dem Mann, der uns aus unserer Wohnung getrieben hatte, erzählt. „Wenn du dich in meinem Namen revanchieren kannst, mach das.“ Was er gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er wird etwas gemacht haben. Ich wollte nicht länger in Wien bleiben, ich konnte mir das alles nicht mehr anschauen.
Die Rückreise nach Theresienstadt war auch sehr abenteuerlich. Zuerst fuhren wir mit einem gemieteten Auto über die Grenze bei Lundenburg [73]. Das war auch illegal, denn die Grenzen waren alle gesperrt. Und dann haben wir es nach Prag geschafft und von Prag nach Theresienstadt. Meiner Mutter habe ich gesagt, dass Wien nichts für uns ist. „In Wien haben wir nichts mehr zu suchen. Was wir zurücklassen mussten, haben wir für immer verloren.“
Inzwischen hatten wir durchs Deutsche Rote Kreuz Kontakt zu meiner Schwester in Palästina. Prochnik ist dann zu uns gekommen und hat uns gesagt, es bestehe eine Möglichkeit, nach Palästina zu kommen. Er habe Kontakt aufgenommen mit dem Joint [74] in Paris. Man könne eine Gruppe aus Theresienstadt in die amerikanische Zone nach Bayern bringen, ob wir Interesse hätten. Ich war sofort damit einverstanden, denn ich wusste, dort’n, wo die Russen sind, kann man nicht auswandern. Das war unmöglich! Von Wien konnte man nicht auswandern, alles war gesperrt. Auswandern konnte man aus dem Gebiet, wo die Amerikaner waren. Das hatte ich schon bald erfahren.
Die Amerikaner haben sehr geholfen. Die Russen haben auch viel geholfen, aber sie hatten nicht die Möglichkeit, sie haben selbst nichts gehabt, sie waren selbst verhungert. Der Prochnik hat uns dann wirklich die Möglichkeit gegeben, nach Bayern auszureisen. So sind wir in das DP-Lager nach Deggendorf gebracht worden. […]
Leo Luster blieb mit seiner Mutter vier Jahre in Deggendorf, bevor die beiden nach Israel emigrieren konnten.
[1] Kurt Schuschnigg (1897–1977), Bundeskanzler des so genannten austrofaschistischen Ständestaates (1934–1938). Nach dem „Anschluss“ wurde Schuschnigg von den Nationalsozialisten bis 1945 in verschiedenen Konzentrationslagern interniert.
[2] Jakob (später Jacques), ein älterer Bruder von Leo Lusters Mutter, war bereits um 1914 nach Amerika ausgewandert. Er konnte zwar seinem Bruder Benjamin und dessen Familie bei der Emigration helfen, nicht aber mehr der Familie von Leo Luster.
[3] Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) ist die Gemeinschaft und Interessenvertretung der österreichischen Jüdinnen und Juden.
[4] 1938/39 wurden etwa zehntausend jüdische Kinder und Jugendliche mit so genannten Kindertransporten in das sichere Ausland, vor allem nach Großbritannien, geschickt.
[5] Jugendalijaschule. Die JUAL-Schule wurde 1938 gegründet, um jüdische Kinder in Theorie und Praxis auf die Auswanderung nach Palästina vorzubereiten. Die JUAL-Schule wurde 1942 zwangsweise geschlossen.
[6] Als „Kristallnacht“ oder „Reichskristallnacht“ wurde der Pogrom gegen Jüdinnen und Juden auf deutschem Reichsgebiet in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 bezeichnet. Der Name leitet sich von den zahlreichen Fensterscheiben, die im Zuge dieser Nacht zerstört wurden, ab. Neben der Plünderung, Zerstörung und Beschlagnahmung von jüdischen Geschäften, Wohnungen, Synagogen und Bethäusern wurden tausende Jüdinnen und Juden verhaftet und zum Teil in Konzentrationslager deportiert, wo viele von ihnen ermordet wurden.
[7] Von 1933 bis 1938 war der österreichische Ableger der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) verboten; deren Mitglieder waren durch das Verbot zu „illegalen“ Nationalsozialisten geworden.
[8] Ab dem Zerfall des Osmanischen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg bis zur Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 wurde u.a. das Gebiet des heutigen Israels und Jordaniens als so genanntes Völkerbundsmandatsgebiet von Großbritannien verwaltet. Die jüdische Immigration war während des Mandats beschränkt, weshalb v.a. nach Beginn des Zweiten Weltkrieges viele europäische Jüdinnen und Juden versuchten, mit illegalen Transporten nach Palästina zu gelangen.
[9] Nach Jerusalem und Tel Aviv drittgrößte Stadt Israels im Norden des Landes.
[10] Eine jüdische paramilitärische Untergrundorganisation während der Zeit der britischen Mandatsverwaltung von Palästina, die unter anderem zum Schutz jüdischer Siedlungen und für die Organisation der illegalen Einwanderung nach Palästina aktiv war.
[11] Mit der „Patria“ sollten jüdische Flüchtlinge, denen von der britischen Mandatsregierung die Einreise nach Palästina verweigert worden war, nach Mauritius deportiert werden. Um dies zu verhindern, schmuggelte die jüdische Widerstandsgruppe Hagana Sprengstoff an Bord, um das vor Haifa liegende Schiff seeuntüchtig zu machen. Bei der Explosion der – falsch bemessenen – Sprengladungen am 25. November 1940 kamen rund 270 Menschen ums Leben.
[12] Auch: Chadera, Stadt in Nordisrael.
[13] Hebräisch für Zahl: Ausdruck für die Anzahl von mindestens zehn jüdischen erwachsenen männlichen Betern, mit der sich eine jüdische Gemeinde konstituiert. Diese Anzahl ist für einen öffentlichen Gemeindegottesdienst notwendig.
[14] Das Erreichen der religiösen Mündigkeit jüdischer Knaben im Alter von 13 Jahren. Bei den Feierlichkeiten in der Synagoge müssen – wie generell bei jüdischen Gottesdiensten – mindestens neun weitere jüdische erwachsene Männer anwesend sein. Die Feier der Bar Mitzwa besteht vor allem darin, dass der Junge zum ersten Mal zum Vorlesen aus der Thorarolle aufgerufen wird.
[15] Im Zuge der großen Deportationen der jüdischen Bevölkerung aus Wien in die Konzentrations- und Vernichtungslager im Osten wurden Sammellager eingerichtet, in denen sich die für die Abtransporte bestimmten Menschen einzufinden hatten. Solche Lager entstanden in der Schule in der Kleinen Sperlgasse 2a, im Chajes-Realgymnasium in der Castellezgasse 35, im Dr.-Krüger-Mädchenheim in der Malzgasse 7 und in der Talmud-Thora-Schule in der Malzgasse 16.
[16] Am 30. Juni 1942 wurde vom Reichserziehungsminister jeder Unterricht für jüdische Schülerinnen und Schüler verboten, alle jüdischen Schulen wurden geschlossen.
[17] Ende des 19. Jahrhunderts entstandene jüdische politische Bewegung, die sich in Reaktion auf den weitverbreiteten Antisemitismus in der jüdischen Diaspora die Gründung eines jüdischen Nationalstaates in Palästina zum Ziel setzte.
[18] Schalom Asch (1880–1957), aus Polen stammender, jiddischer Schriftsteller.
[19] Neben zahlreichen anderen Einschränkungen und Diskriminierungen war Jüdinnen und Juden nach dem „Anschluss“ auch das Betreten von Parkanlagen verboten worden. Der Jüdische Friedhof am Wiener Zentralfriedhof war einer der wenigen Orte, die als „Park“ für Wiener Jüdinnen und Juden zugänglich waren.
[20] Deutsches KZ in Bayern,
[21] Deutsches KZ in Thüringen.
[22] Eine eidesstattliche Erklärung, die für die Einreise in viele Länder, wie z.B. Großbritannien oder die USA, benötigt wurde.
[23] Adolf Eichmann (1906–1962), zentrale Person bei der Organisation der Vertreibung und Deportation der Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus. Nach dem Krieg flüchtete Eichmann nach Argentinien, wurde aber von israelischen Agenten aufgespürt und nach Israel gebracht, wo ihm der Prozess gemacht wurde. Er wurde zum Tode verurteilt und 1962 in Israel hingerichtet.
[24] Die Wiener „Zentralstelle für jüdische Auswanderung" war hauptverantwortlich für die Vertreibung und später Deportation der österreichischen Jüdinnen und Juden.
[25] Abkürzung für Geheime Staatspolizei. Die Gestapo war die Politische Polizei des NS-Staates, und ihre Aufgabe war die Bekämpfung und Verfolgung politischer GegnerInnen.
[26] Ultraorthodoxe jüdische Organisation.
[27] Als „Halbjude“ oder „Mischling 1. Grades“ wurde eine Person bezeichnet, die zwei jüdische Großeltern hatte, nach der ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 aber nicht „als Jude galt“. Dennoch war diese Personengruppe von verschiedensten diskriminierenden Gesetzen betroffen. „Vierteljude“ oder „Mischling 2. Grades“ war eine Person, unter dessen Großeltern sich eine Jüdin oder ein Jude befand. Zwar wurde auch diese Personengruppe diskriminiert, zu generellen Verfolgungsmaßnahmen kam es aber nicht.
[28] Vom ehemaligen Aspangbahnhof in Wien wurden in 47 Transporten rund 50.000 österreichische Jüdinnen und Juden in die nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Leo Luster hat sich für die Errichtung eines Mahnmals auf dem Areal des Aspangbahnhofes eingesetzt. Dieses soll im Laufe des Jahres 2017 errichtet werden.
[29] Bohušovice nad Ohří (deutsch: Bauschowitz an der Eger). Über Bauschowitz war Theresienstadt an das Bahnnetz angebunden.
[30] Die SS („Schutzstaffel“), ursprünglich eine kleine paramilitärische Formation der NSDAP, entwickelte sich zu einer der größten und mächtigsten Organisationen des „Dritten Reichs“ und machte sich im Zweiten Weltkrieg unzähliger Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig.
[31] Siegfried Seidl (1911–1947) wurde im Oktober 1941 mit dem Aufbau des Ghettos Theresienstadt beauftragt und war dort von November 1941 bis Juli 1943 Lagerkommandant. Nach dem Krieg tauchte er in Wien unter. Er konnte schließlich verhaftet werden und wurde 1947 hingerichtet.
[32] Anton Burger (1911–1991) war von Juli 1943 bis Februar 1944 Lagerkommandant im Ghetto Theresienstadt. Nach dem Krieg wurde er zum Tode verurteilt, konnte aber vor seiner Hinrichtung fliehen. Er lebte bis zu seinem Tod 1991 unerkannt unter falscher Identität in Deutschland.
[33] Karl Rahm (1907–1947) war von Februar 1944 bis Mai 1945 Lagerkommandant im Ghetto Theresienstadt. Er wurde 1947 hingerichtet.
[34] In Westerbork befand sich ein Durchgangslager der deutschen Besatzungsmacht für die Deportation der niederländischen Jüdinnen und Juden in die Konzentrations- und Vernichtungslager.
[35] Jakob Edelstein (1903–1944) war als erster so genannter Judenältester der Vorsitzende des „Ältestenrates“ im Ghetto Theresienstadt und stand in dieser Funktion der von der SS-Lagerleitung kontrollierten „jüdischen Selbstverwaltung“ des Ghettos vor. Er wurde 1943 nach Auschwitz deportiert und 1944 dort ermordet.
[36] Aron Menczer (1917–1943) war nach dem „Anschluss“ für die Jugendalija, eine jüdische Organisation, die jüdische Kinder und Jugendliche während des Nationalsozialismus außer Landes in Sicherheit brachte, tätig. Er wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert. 1943 wurde er gemeinsam mit über 1.000 Waisenkindern, die aus dem Ghetto Białystok in Polen nach Theresienstadt gebracht worden waren und um die er sich kümmerte, nach Auschwitz deportiert. Dort wurden er und die Waisenkinder sofort nach ihrer Ankunft vergast. In der Wiener Marc-Aurel-Straße 5, an jenem Ort, an dem sich die JUAL-Schule befunden hatte, an der Aron Menczer Lehrer gewesen war, erinnert eine Gedenktafel an ihn.
[37] In der Nähe von Minsk im heutigen Weißrussland befand sich die Vernichtungsstätte Maly Trostinec, wo bis zu 60.000 Jüdinnen und Juden ermordet wurden.
[38] Infektionskrankheit, die ohne Behandlung zum Tod führen kann.
[39] Der höchste jüdische Feiertag, ein strenger Ruhe- und Fasttag mit 24-stündigem Fasten, der im Herbst begangen wird.
[40] Grenzregion im heutigen Polen, Deutschland und Tschechien.
[41] Polnisch Wrocław, Stadt im Süden des heutigen Polen.
[42] Polnisch Kraków, Stadt im Süden des heutigen Polen.
[43] In Auschwitz-Birkenau bestand ein eigenes Lager für Roma und Sinti, das „Zigeunerfamilienlager Auschwitz“ im Lagerabschnitt B II e. Von den über 22.000 dort Inhaftierten wurden fast 20.000 Menschen ermordet. Nach der Liquidierung des Lagers im Sommer 1944 wurden dort andere Häftlinge untergebracht.
[44] Die Duschen und die Gaskammern befanden sich in unterschiedlichen Gebäuden.
[45] Ein Teil der Häftlinge in den nationalsozialistischen KZ bestand aus verurteilten Straftätern. Diese wurden – neben aus politischen Gründen Inhaftierten – von der Lagerleitung oft als so genannte Funktionshäftlinge eingesetzt, die die Aufsicht über ihre Mithäftlinge führen mussten.
[46] Bezeichnung für bestimmte Funktionshäftlinge.
[47] In Auschwitz wurden alle, die ins Lager aufgenommen wurden, tätowiert. Diejenigen, die nicht tätowiert wurden, wurden in den Gaskammern ermordet.
[48] Nach den jüdischen Vorschriften für die Zubereitung und den Genuss von Speisen und Getränken gelten jene Lebensmittel als koscher, die zum Verzehr erlaubt sind.
[49] Yosef Almogi (1910–1991), israelischer Politiker. Almogi war 1941 als Soldat der Britischen Armee in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten.
[50] Dachverband der Gewerkschaften Israels.
[51] Deutsches Konzentrationslager in Niederschlesien im heutigen Polen.
[52] Der fünfzackige rote Stern ist das Symbol für die Sowjetunion.
[53] Auch: Dysenterie, eine bakterielle Darminfektion.
[54] Polnisch Poznań, Stadt im Westen des heutigen Polen.
[55] Region im Süden des heutigen Polen.
[56] Polnisch Katowice, Stadt in Oberschlesien.
[57] Grenzfluss zwischen Polen und Deutschland.
[58] Der größte Teil der Region Niederschlesien liegt heute in Polen.
[59] Stadt in Deutschland, an der Grenze zum heutigen Polen gelegen.
[60] DP: Abkürzung für Displaced Persons, Personen, die sich aufgrund des Krieges nicht in ihrem Heimatland aufhielten und nicht die Mittel hatten zurückzukehren oder sich in einem anderen Land anzusiedeln, wie z. B. Zwangsarbeiter oder KZ-Überlebende.
[61] Stadt im Osten Deutschlands.
[62] Infektionskrankheit, die meist die Lunge befällt und tödlich enden kann.
[63] Hebräisch für Erzieher.
[64] In Deggendorf in Bayern befand sich ein DP-Lager.
[65] Die Rolle des Wiener Rabbiners Benjamin Murmelstein (1905–1989), des letzten Judenältesten Theresienstadts, war nicht ganz unumstritten. Er wurde nach dem Krieg unter dem Verdacht der Kollaboration mit den Nationalsozialisten festgenommen, von einem tschechischen Gericht jedoch freigesprochen.
[66] Robert Prochnik (1915–1977), ein enger Mitarbeiter von Benjamin Murmelstein, wurde nach dem Krieg ebenfalls der Kollaboration beschuldigt. Ein diesbezügliches Verfahren gegen ihn in Österreich wurden eingestellt.
[67] Nach der Befreiung Theresienstadts durch sowjetische Einheiten übernahm der Prager Kommunist Ing. Jiří Vogl die Leitung des ehemaligen Ghettos.
[68] Theresienstadt diente von 1945 bis 1948 als Internierungslager für Sudetendeutsche – Angehörige der deutschen Volksgruppe in Böhmen und Mähren –, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges aus der wiedererrichteten Tschechoslowakei vertrieben wurden.
[69] Österreichischer Politiker (1870–1950). Von 1918 bis 1920 war Renner Staatskanzler und damit maßgeblich an der Entstehung der Ersten Republik beteiligt, von 1931 bis zur „Selbstausschaltung“ des Parlaments 1933 war er Nationalratspräsident und von 1945 bis zu seinem Tod 1950 erster Bundespräsident der Zweiten Republik.
[70] Eine mithilfe von Pontons (Schwimmkörper) direkt auf einem Gewässer liegende Brücke.
[71] Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Österreich von den alliierten Siegermächten in vier militärische Besatzungszonen eingeteilt: die sowjetische, US-amerikanische, französische und britische
[72] Das Innenministerium der ehemaligen UdSSR.
[73] Tschechisch Břeclav, Stadt in Tschechien, an der Grenze zu Niederösterreich gelegen.
[74] American Jewish Joint Distribution Committee, eine seit 1914 tätige Hilfsorganisation US-amerikanischer Jüdinnen und Juden, die nach der NS-Machtergreifung in Deutschland und später in Österreich jüdischen Menschen bei der Emigration behilflich war. Während und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Joint – vor allem durch Lebensmittellieferungen und Spendengelder – zur wichtigsten Hilfsorganisation für Überlebende des Holocaust.