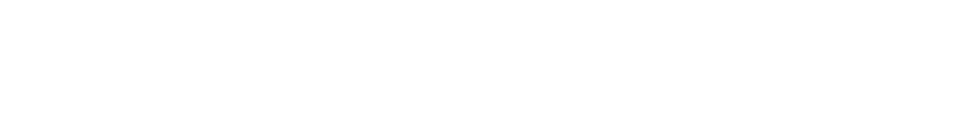Edith A.
In der Sperlgasse
Ich wurde am 31. Juli 1924 in Wien geboren. Meine Eltern heirateten am 4. November 1926. Mein Vater war Jude, aber damals ein Freidenker, meine Mutter Christin. Als die Ehe geschlossen wurde, ging sie der jüdischen Religion zu. Beide waren berufstätig, und aus diesem Grund lebte die Schwester meiner Mutter bei uns, die mich und meinen Bruder in ihrer christlichen Religion erzog, obwohl wir laut Matrikelamt der Israelitischen Kultusgemeinde als jüdisch eingetragen waren.
Als mein Bruder 1932 bei einem Autounfall tödlich verunglückte, machten sich meine Eltern Vorwürfe und die Ehe scheiterte. 1935 wurde sie schließlich geschieden. Ich wurde aber gleich nach dem Tode meines Bruders in das jüdische Heim Menores (Menores Itzeles für israelitische Mädchen, XIX. Bezirk, Bauernfeldgasse; eigentlich ein Waisenhaus) untergebracht, was bedeutete, dass meine Tante keinen weiteren Einfluss auf meine Erziehung mehr ausüben konnte. Ich lebte dort bis zur endgültigen Scheidung meiner Eltern. Ich wurde schließlich meiner Mutter zugesprochen.
Bald darauf versöhnten sich aber beide Elternteile, und es war die Rede, sich wieder zu verheiraten. Beide arbeiteten gemeinsam in ihrer Konditorei bis 1938, als Hitler in Österreich einmarschierte. Meine Mutter und ich wohnten damals, nach der Scheidung, in der Fechtergasse im IX. und mein Vater im XX. Bezirk in der Karajangasse. Da die Gefahr von Aushebungen sehr groß war, beherbergte ihn meine Mutter eine lange Zeit. 1939 konnte er schließlich emigrieren.
Um meinen jüdischen Hintergrund geheim zu halten, nahm mich Mutter sofort aus der Schule heraus, obwohl ich erst im Juli 14 Jahre alt geworden wäre. So erhielt ich, da ich erst 13 Jahre alt war, auch kein Abschlusszeugnis. Meine Mutter hoffte, meine Abstammung geheim halten zu können und versuchte, mich, als ich 15 Jahre alt geworden war, in irgendeiner Schule unterzubringen. Ich hatte immer schon ein Talent zu malen. Endlich gelang es meiner Mutter, mich – da ich kein Abschlusszeugnis erbringen konnte mittels teurer Bestechungen – in die Modeschule für das Bekleidungsgewerbe zu schicken. Leider ging dies nur für knapp ein Jahr gut, da ich trotz wiederholter Mahnungen und Herausschiebungen keinen "Ariernachweis" erbringen konnte. Das Wichtigste war aber, dass ich einen Schülerausweis erhalten hatte, der mir später vermutlich das Leben rettete.
Der Betrieb meiner Mutter wurde durch einen Befehl des Reichskommissars [1] unwiderruflich gesperrt, da der Umsatz zu klein geworden war, weil es keine Mittel für Luxuserzeugnisse gab, und sie stand nun vor der Aufgabe, nicht nur den Zins für das Geschäft zu bezahlen, in der Hoffnung es wenigstens verkaufen zu können, sondern auch den Zins für die Wohnung und überhaupt einen Lebensunterhalt für uns beide zu finden.
Da die Unterkünfte in Wien sehr ausgelastet waren, konnte man "patriotisch" freie Zimmer anmelden. Meine Mutter und ich schliefen nun in einem Bett in einem kleinen Kabinett, und alle anderen Räume wurden vermietet. Es war leicht, Mieter vom Verkehrsamt und dem benachbarten Hotel "Belle a View" zu bekommen. Wir beide wuschen die Leintücher usw. und konnten auf diese Weise durchkommen.
Ich ging zu dieser Zeit weiter in die Schule, wo ich ein komplettes Doppelleben führte. Wie überall war die Jugend aufgehetzt und vom Nationalsozialismus indoktriniert. Es war ein großer Teil der Schulung. Niemand wusste, welch ein "Fremdling" unter den Schülern saß, und ich war in ständiger Angst entdeckt zu werden.
Unter den Gästen, die wir in unserer Wohnung aufnahmen, war ein Ehepaar aus dem Rheinland. Der Mann war bei der SS und in einem Lager stationiert. Seine Frau ließ die Kinder bei den Großeltern im Rheinland, und sie trafen sich oft bei uns. Der Mann musste oft ein bis zwei Tage warten, bis seine Gattin eintraf, und so hatten wir Zeit zur Unterhaltung. Wir hatten in der Schule gelernt, dass die Juden fern von ihrem Heimatland in einem Ghetto ein neues Leben gründen könnten, und ich war sehr neugierig, was mit ihnen geschehen würde, insbesondere weil eine Direktorin, Frau Bodenstein, die mit Direktorin Lehman (Direktorin des Menores Heims) oft zu uns kam und sogar ein paar Tage bei uns blieb, weil sie sich in Gefahr fühlte, eines Tages nicht mehr kam. Da der Mann zu verstehen gab, in so einem großen Lager zu arbeiten, fragte ich ihn, was nun mit den Juden geschehen würde, die nach unseren Lehrern in der Schule nicht einmal eine "ehrliche Kugel" wert waren. Ich muss annehmen, dass ich eine der Ersten gewesen sein muss, die nun erfuhren, dass diese unglücklichen Wesen unter dem Vorwand, in die Waschhäuser zu marschieren, um sich zu brausen, gleichzeitig durch Giftgas getötet wurden.
Ich weiß heute nicht mehr, wie es mir gelang, meine Haltung zu bewahren, als ich dies erfuhr. Ich hatte zur selben Zeit Vorladungen vom Gestapo-Hauptquartier am Morzinplatz. Es wurde mir vorgeworfen, ausländische Sender gehört zu haben, was vollkommen lächerlich war, da unser Radio keinen so großen Empfangsbereich hatte und – obwohl ich Privatunterricht in Englisch bekommen hatte – mein diesbezügliches Wissensvermögen viel zu klein war, dass ich etwas hätte verstehen können. Es war immer eine große Aufregung, vorgeladen und angeschrieen zu werden, und ich kann nur annehmen, dass die Gestapo irgendetwas ausfindig machen und meine Mutter unter Druck setzen wollte.
Oft hörten wir in der Nacht und manchmal auch tagsüber das schreckliche Geschrei der Angehörigen, deren Männer von den Wohnungen ausgehoben wurden. Man hörte, dass sie nach Dachau gebracht wurden und als Asche zurückkamen.
Was ich von diesem SS-Mann gehört hatte, beschäftigte ständig meine Gedanken, und ich wusste, dass ich mich nie auf solche Menschen verlassen würde können. Ich erinnere mich ihn gefragt zu haben, ob er manchmal einen gewissen Druck verspürt hätte, sich so etwas mitanzusehen. Ich war überrascht, als er mir antwortete, es wäre ihm einmal so ergangen. Eine hochschwangere Frau, die neben ihrem Gatten marschierte, brach plötzlich zusammen und gebar. Man gab ihr die Möglichkeit zurückzubleiben, aber sie stand auf und ging weiter neben ihrem Mann. Dies hatte ihn erstaunt.
Immer wieder musste ich in späteren Jahren daran denken. Wie war es nur möglich, dass so ein sympathischer Mensch, der ohne Zweifel ein guter Gatte und Familienvater war, zu solch einer Arbeit fähig war? Er hatte bestimmt nicht viele Juden kennengelernt, obwohl er vielleicht zehn oder zwölf Jahre älter war als ich. Wahrscheinlich nur durch die Hitlerjugendpropaganda. Sein Erstaunen war groß, als er eine "andere Seite" an diesen Menschen entdeckt hatte. Aber wie man nur allzu oft hörte, gab es unter dieser "verhassten Judenrasse" eben immer auch AUSNAHMEN.
Ich wurde eines Tages inmitten meiner Schulaufgaben von zwei SS-Männern aus der Wohnung geholt. Meine Mutter kam gerade zufällig nach Hause, als ich durch die Haustür ging. Sie war damals bereits gesundheitlich sehr mitgenommen und war am Tag zuvor auf der Stiege bewusstlos geworden, als sie die Kohlen heraufbringen wollte. Sie bettelte, dass die SS-Männer sie auch mitnehmen sollten, aber umsonst. Sie versuchte, sich an den Lastwagen hinten anzuhängen, in dem ich saß.
Ich wurde in die Sperlgasse gebracht, eine ehemalige Schule, die nun als Abtransportlager [2] diente. Ich sah meine Mutter nur selten. Einmal wurde ich Herrn Brunner [3] in einem Palais in der Prinz-Eugen-Straße vorgeführt. Dort saßen wir wie viele andere Mitleidende stundenlang in einer großen Vorhalle und brachten wie meine Mutter Geld und Schmuck, um Zeit und Gnade zu gewinnen. Es wird mir schlecht, wenn ich daran zurückdenke.
Meine Mutter versuchte alles, um Zeit zu gewinnen. Sie ging zu den Behörden und gab dort an, dass mein Vater gar nicht der leibliche Vater gewesen wäre. Das Anthropologische Institut in der Währinger Straße verglich aber Fotografien von uns und befand, dass eine große Ähnlichkeit zwischen mir und meinem Vater bestand. Meine Mutter versuchte alles nur Mögliche. Umsonst! Ich wusste, dass ich ganz auf mich alleine gestellt war und niemals einer Behörde vertrauen durfte.
Viele Monate vergingen. Von den Frauen, die mit mir gemeinsam in einem Raum waren, war ich die Jüngste. Eine sehr elegante, vielleicht 50-jährige Dame erzählte, dass ihr Mann Franzose wäre und dass er alles unternehmen würde, ihr herauszuhelfen. Wie sollte er aber nur erfahren, wo sie war? Sie hatte ein Konzert besucht und war vor dem Konzerthaussaal verhaftet worden. Eine andere, ganz in schwarz gekleidete Dame beschwerte sich, dass sie nicht einmal eine Bürste dabei hätte, um ihre Kleider zu bürsten. Es war alles so lächerlich. Ein sehr elegantes Fräulein, das bestimmt drei bis fünf Jahre älter war als ich, erzählte, dass sie ein Fräulein Adler wäre. Die Tochter des Schreibmaschinenfabrikanten. Ihre Familie wäre bereits in der Schweiz, und sie selbst wäre nur zurückgekommen, um noch etwas Geschäftliches zu erledigen, aber dann wurde sie verhaftet. Sie versuchte dies noch zu verzögern, indem sie ins Rothschildspital ging, aber auch dort wurde sie bewacht, und letztendlich kam sie zu uns in die Sperlgasse. Ich war sehr beeindruckt, denn sie war so gepflegt und ihre Nägel so perfekt, nicht wie meine verwaschenen Hände. Sie erzählte, sie hätte bereits ihr eigenes Auto, was zu dieser Zeit außergewöhnlich war. Eines Tages hörten wir aus den Toilettenanlagen einen Lärm. Die alte Dame hatte mittels einer Spritze Selbstmord begangen. An die anderen Frauen kann ich mich kaum noch erinnern. Oft denke ich, was aus dem Fräulein Adler geworden ist.
Sie war groß und schlank und schön und ihre Familie so berühmt, aber sie landete auch hier. Unten im Hof waren Nähmaschinen und Möbel gelagert. So viel Hoffnung hatten alle, wieder irgendwo ihr Leben aufzubauen. Ich hatte meine eigenen Gedanken, die ich bei mir behielt, und gar keine Hoffnung auf eine Zukunft.
Endlich war es so weit. Wir hatten unsere J-Kennkarten und den "Stern" [4] und kamen in die Wägen. Dies dauerte sehr lange, und ich sah vorläufig keine Möglichkeit zu entkommen.
Oft wurde angehalten, und bei erstbester Möglichkeit rannte ich davon. Die Angst vor dem, was ich von dem SS-Mann gehört hatte, war in mir geblieben und machte mir dieses Wagnis möglich.
Ich versteckte mich in einem Frachtwaggon, nachdem ich über die Schienen gelaufen war. Stundenlang später fuhr er an, und ich hoffte dann, bei Dunkelheit fortlaufen zu können. Ich entfernte meinen Stern und fand die eingenähte Schülerkarte und etwas Geld in meinem Trachtenanzug, den ich immer trug. Ich rannte abermals davon, aber diesmal wurde ich aufgegriffen, als ich mich bei einem Bahnhof unter die Leute, die gerade aus einem Zug strömten, mischen wollte. Ich wurde angeschrieen und in einen Zug gesetzt. Woher hätte ich wissen sollen, dass ich mich in einem abgesperrten Zug befinden würde, der durch das Protektorat fuhr, und auch das wichtigste Personal den Zug verlassen hatte? Ich sagte, ich hätte alles verloren, aber man war gar nicht daran interessiert.
So erfuhr meine Mutter, dass ich, Fräulein Fürst, Fachschülerin, am 16. Juli 1943 die Protektoratsgrenze unbefugt überschritten hatte, ohne den erforderlichen Durchlassungsschein mit sich zu haben. Als Beweismittel galt mein Geständnis.
Meine Mutter bezahlte die Geldstrafe und die Gerichtskosten von insgesamt zwölf Reichsmark mit großer Freude, da sie jetzt endlich wusste, dass ich am Leben war.
Ich glaube, es war Leipzig, als ich aus dem Zug stieg. Ich sah nur einen großen Bahnhof und hatte mir vorgenommen, wenn möglich nach Erfurt zu fahren, wo ich die Adresse einer Dame hatte, die einmal mit ihrer Tochter bei uns zu Gast gewesen war und der ich so gut gefallen hatte. Sie hatte ihren Mann und Schwiegersohn, der in Wien in einem Lazarett lag, besucht. Die Adresse war leicht zu merken gewesen. Ihr Name war Hagenbring, und ihr Mann war der Wächter der Jägerkaserne in Erfurt. Sie und ihr Mann lebten dort in einem Bungalow. Das Erstaunen war groß, als sie von einem der Wächter zum Eingangstor gerufen wurden und mich dort vorfanden.
Ich wurde mit großer Freude aufgenommen. Ich bat, ein paar Tage bleiben zu dürfen, und dies wurde mit Freude bejaht. Ich hatte kein Gepäck, einfach nichts, und Frau Habenbring musste mir ihr Vertrauen schenken, obwohl ich ihr nicht alles sagte, aber es war ihr genug. Ich half ihr im Haushalt und auch am Feld, das sie neben der Kaserne übernommen hatte, um Gemüse und Kartoffeln anzupflanzen. Sie hatte Hasen in einem Käfig und ein Schwein, das geschlachtet wurde. Dafür musste sie ihre Lebensmittelkarten für das Fleisch geben, aber sie hatten alles in Hülle und Fülle, während ich ganz verhungert war.
Ich half ihr beim Waschen etc., und ihren Bekannten wurde gesagt, dass ich mein Pflichtjahr bei ihr machte.
Es waren ein paar schöne Monate, sie borgte mir ein Fahrrad, und ich machte Ausflüge in den Thüringer Wald. Es war zu schön, um lange dauern zu können. Als ich einmal in die elektrische Bahn einsteigen wollte, stand sie mit zwei Koffern und voller Tränen da. Sie hatte sich ihrer Schwiegertochter Erna anvertraut, und diese war sofort zur Kriminalpolizei gegangen. Sie gab mir Kleider, Lebensmittel und ihre Coupons. Sie gab mir außerdem noch Geld, Adressen sowie eine Fahrkarte nach Berlin, und ich befand mich wieder voller Sorgen auf dem Weg. Mit großer Verspätung kam der Zug in Berlin an, und ich begab mich mit vielen anderen Reisenden auf die Suche nach einem Zimmer.
Am nächsten Morgen suchte ich die erste Adresse auf, aber die Leute waren ausgebombt. Ich lebte ohne eine Legitimation und Lebensmittelkarten. Und hier fing ein neues Kapitel in meinem Leben an. Es war noch lange bis Kriegsende, sehr sehr lange. Ich könnte ein Buch schreiben ... Es ist unmöglich, alles nur in Schlagworte zu fassen, aber selbst das Wenige, das ich geschrieben habe, war sehr nervenaufreibend für mich.
Die Erstveröffentlichung dieses Artikels erfolgte in: Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus (Hg.): In die Tiefe geblickt. Lebensgeschichten. Edition INW Wien 2000, Seite 29-34.
[1] Der "Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich" in Person von Josef Bürckel hatte für den politischen Aufbau und die Durchführung der staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen "Wiedereingliederung" Österreichs in das Deutsche Reich zu sorgen.
[2] In der Kleinen Sperlgasse 2a befand sich ein "Sammellager", in welchem die jüdischen Insassinnen und Insassen auf ihre Deportation in die östlichen Konzentrations- und Vernichtungslager warten mussten.
[3] Alois Brunner, ein Mitarbeiter Adolf Eichmanns, war der Dienststellenleiter der Wiener "Zentralstelle für jüdische Auswanderung"; diese Institution war hauptverantwortlich für die Vertreibung und später Deportation der österreichischen Jüdinnen und Juden.
[4] Ab Jänner 1939 mussten jüdische Bürgerinnen und Bürger spezielle Kennkarten bei sich tragen und ab September 1941 mussten Jüdinnen und Juden einen "Judenstern" als Zeichen der Ausgrenzung auf ihrer Kleidung tragen.