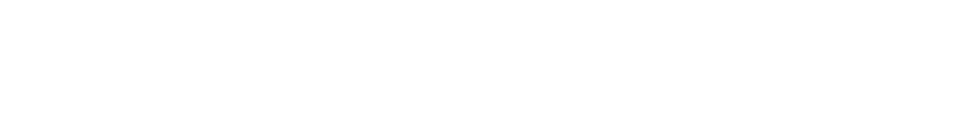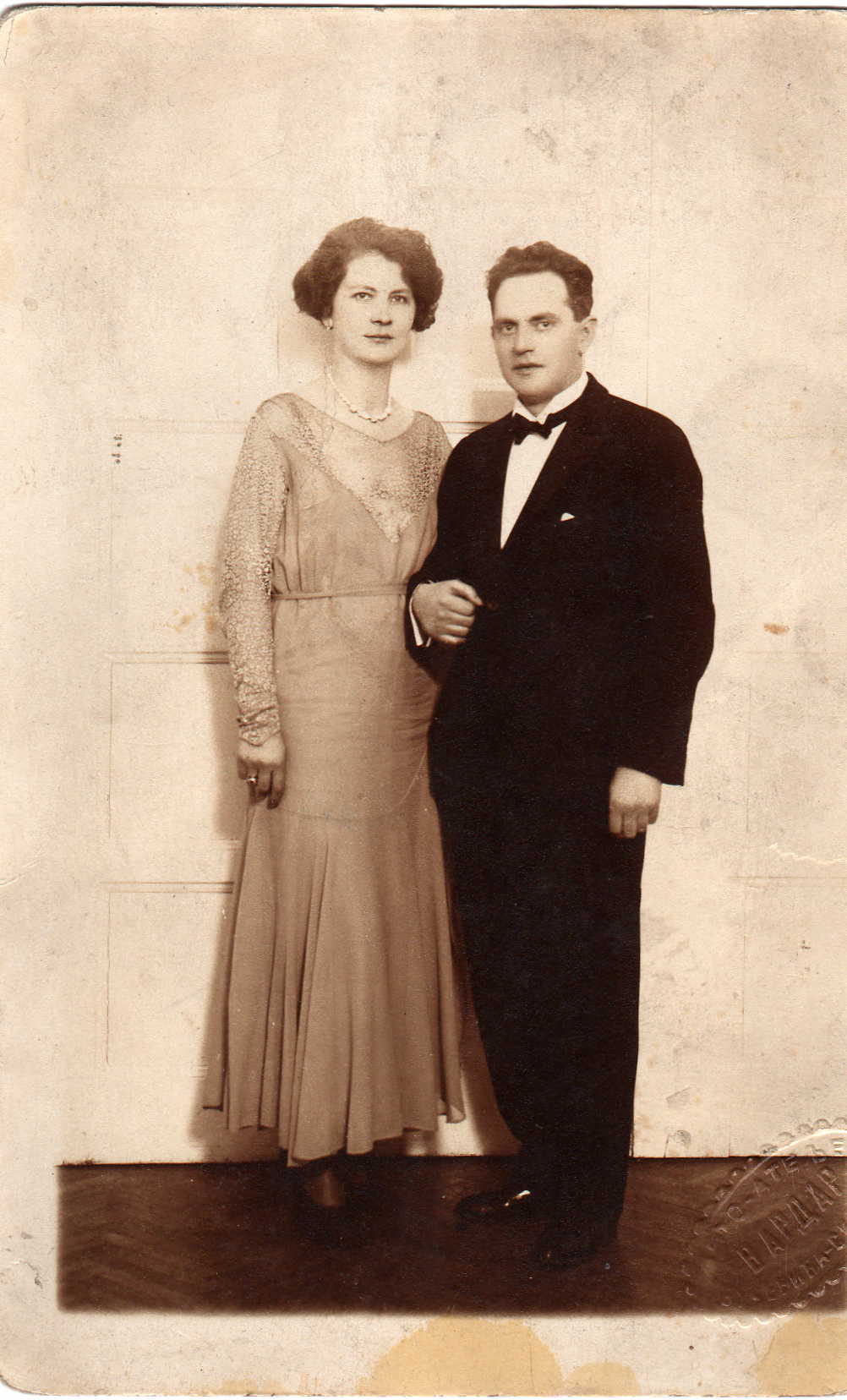Hans Gamliel
Wien 2. Bezirk, Tempelgasse Nr. 3 (Erinnerungen von 1943 bis 1953)
Hans Gamliel wurde am 25. Dezember 1940 in Subotica (heutiges Serbien) geboren. Er lebt heute in der Schweiz.
Seine Mutter Dorothea war aufgrund ihrer jüdischen Abstammung als junge Frau 1938 vor den Nationalsozialisten von Wien nach Serbien geflüchtet und hat dort versteckt den Holocaust überlebt. Während dieser Zeit hat sie zwei Kinder, Hans und Erika, geboren. 1945 kehrte Dorothea mit ihren beiden Kindern nach Wien zurück, wo die Familie lange Zeit in einem kleinen Zimmer im jüdischen Obdachlosenheim leben musste, bevor sie 1953 in eine eigene Wohnung übersiedeln konnte.
Seine Familiengeschichte und seine Kindheitserinnerungen erzählt Hans Gamliel im nachfolgenden Text in der dritten Person.
1.Emigranten
Es muss 1943 oder 1944 gewesen sein. Hans war drei Jahre alt geworden. Nach seiner Geburt wurde er von seiner Mutter mit dem Namen Hans bedacht. Aus Sicherheitsgründen wurde der Knabe jedoch mit einem serbischen Namen gerufen. Sein Erinnerungsvermögen begann sich um diese Zeit zu bilden und vieles, was seither geschah, für immer in seinem Gedächtnis festzusetzen. Bei serbischen Bauersleuten hatten er und seine Mutter, sie hieß Dorothea, Unterschlupf gefunden. Es war ein kleines Bauernhäuschen auf dem Lande, in welchem sie ein winziges Zimmer benutzen durften. Auch Erika, seine um zwei Jahre jüngere Schwester, ebenfalls mit einem serbischen Namen gerufen, war mit ihnen, doch daran konnte Hans sich nicht erinnern. Dorothea und ihre beiden Kinder waren gezwungen, sich in diesen Jahren versteckt zu halten, weil ein gewisser Mann namens Hitler die „Endlösung“ [1] des so genannten Judenproblems in Europa anstrebte, und sie waren Juden.
Hans und seine Mutter lagen, er fest von ihr umschlungen, auf einem Bett. Beide lauschten, sie bestimmt angstvoller als er, dem markanten Geheul der gerade jene Gegend überfliegenden Stukas (Sturzkampfbomber). Auch, zwar nur vage, mochte Hans sich an die übermächtig stark strahlenden Scheinwerfer erinnern, die, sobald die Nacht hereinbrach, das Himmelsgewölbe nach Flugzeugen absuchten. Viele Jahre später kam Hans exakt diese Episode immer dann wieder in den Sinn, wenn er eine Kinovorstellung besuchte. Eine amerikanische Filmgesellschaft verwendete nämlich im Vorspann – als ihr Markenzeichen – solche starken, in den nächtlichen Himmel strahlenden Scheinwerfer.
Lustig fand es Hans, wenn er mit seiner Mutter auf dem Perron eines Vorortbahnhofes stand, um auf eine der spärlichen, zudem unregelmäßigen Zugverbindungen zu warten. Selbstverständlich waren Dorothea und ihre Kinder längstens mit von serbischen Freunden bestens gefälschten Papieren ausgestattet worden, welche sie als jugoslawische Staatsbürger auswiesen. Derweil sie so warteten, kam es vor, dass aus einem kleinen, die Ortschaft überfliegenden Doppeldecker haufenweise Zettel abgeworfen wurden. Diese flatterten in einem weiten Umfeld, aber auch in ihrer unmittelbaren Nähe hernieder. Auf diesen waren Parolen aufgedruckt, die zum Widerstand gegen Nazideutschland und die Landbesetzer oder zur Denunziation von Partisanen und deren Sympathisanten aufriefen, je nachdem, welche Gruppe gerade in der Lage war, derlei Material gefahrlos abwerfen zu können. So jedenfalls erklärte es Dorothea ihrem Sohn, als er sie später einmal darüber fragte, was er aber leider viel zu selten tat.
Hans war mitten in die schrecklichen Kriegsjahre am 25. Dezember 1940 geboren worden. Sein Geburtsort, ein winziges Nest, lag direkt an der ungarischen-jugoslawischen Grenze. Der Ort heißt Subotica, der von den Ungarn aber Szabadka genannt wird. Sein einprägsames Geburtsdatum ließ seine Mutter bei Erzählungen darüber immer das gleiche sagen, nämlich, dass ihr Sohn für sie ein viereinhalb Kilo schweres Weihnachtsgeschenk gewesen war. Als Dorothea selbst noch Kind gewesen, hielt sie sich oftmals mit ihren Eltern, ihren drei Geschwistern, der Großmutter, die von allen Amama genannt wurde, und den beiden Schwestern ihres Vaters, welche Dorothée und Fridica hießen, in Jugoslawien auf. Ihr Vater, Adlerico Gamliel, war Kaufmann von Beruf und Honorarkonsul. Er handelte mit Waren aller Art, am häufigsten jedoch mit Rohseide und Rohkaffee. Mit seiner Arbeit und dem daraus resultierenden recht guten Verdienst konnte er seine große Familie, zu welcher wie erwähnt auch seine Mutter Lea (Amama) und seine beiden Schwestern zählten, sehr gut ernähren und den einigermaßen aufwendigen Lebensunterhalt ebenso gut bestreiten. Adlericos Vater, Jacques Gamliel, gehörte seit einiger Zeit nicht mehr dazu. Er war schon früher, als sie noch in Thessaloniki lebten, wo er ein künstlerisches Fotoatelier betrieb, an Herzversagen verstorben.
Jacques Gattin Lea stammte aus Thessaloniki in Griechenland, er aus Varna in Bulgarien. Nach Jacques Ableben zog Lea mit ihren drei Kindern Adlerico, Dorothée und Fridica von Griechenland nach Österreich, wo sie sich in Wien niederließen. Hier lernte Adlerico eine junge Dame, die ausgebildete Konzertpianistin war, kennen. Sie hieß Elfriede Klein und war ebenso von ihm wie er von ihr angetan. Adlerico, der fesche, erfolgreiche jüdische Kaufmann, machte der jungen wie hübschen Pianistin lange Zeit den Hof. Schlussendlich gestanden sie sich ihre gegenseitige Liebe ein und fassten den Entschluss zu heiraten. Die Vermählung verzögerte sich aus folgendem Grund: Elfriede wollte unbedingt die Religion ihres Zukünftigen annehmen und vom katholischen zum jüdischen Glauben konvertieren. Deshalb musste sie einiges zu lernen in Kauf nehmen, um nach jüdischer Sitte im jüdisch-türkischen Tempel Wiens, der im zweiten Bezirk in der Zirkusgasse stand, getraut werden zu können. Das junge Ehepaar hatte in der Liniengasse 40, im sechsten Bezirk Wiens, eine größere Wohnung erworben. In diesem Hause kamen ihre beiden älteren Kinder Dorothea und Gaston auf die Welt. Die jüngeren, es wurden Zwillinge, welche die Namen Yvonne und Albert erhielten, erblickten während eines Aufenthalts in Jugoslawien das Licht der Welt. Daheim wurde griechisch, türkisch, spanisch, serbokroatisch, französisch und natürlich auch das gern gehörte Wienerisch gesprochen. Häufig wurden Feste abgehalten und gefeiert, dazu viele Freunde und Bekannte empfangen und großzügig bewirtet. Adlerico hatte seiner geliebten Gattin einen prachtvollen, schwarzen Konzertflügel geschenkt gehabt, der in einem der vielen Zimmer aufgestellt worden war. Viel zu oft wurde Elfriede, so sie Besuch hatten, von Anwesenden gebeten, auf dem Flügel etwas zum Besten zu geben. Ebenso oft kam sie gerne den Bitten nach. Manches Mal wurde es ihr jedoch aus welchen Gründen auch immer zu viel. Einmal, als wiederum eine größere Gesellschaft zugegen war, wurde Elfriede zu fortgeschrittener Zeit wie oftmals davor gebeten, doch noch etwas auf dem Klavier vorzuspielen. Sie war nicht erpicht darauf und meinte, um damit dem andauernden Bitten Einhalt zu gebieten, nur auf einem weißen Flügel spielen zu können. Selbstverständlich hatte sie dies nur im Spaß, jedoch mit ernster Miene, gesagt. Adlerico richtete es am darauffolgenden Tag so ein, dass seine Gattin für längere Zeit außerhalb des Hauses zu tun haben musste. Ohne ihr Wissen ließ er dann den schwarzen Flügel gegen einen weißen austauschen. Natürlich gab es, sobald Elfriede wieder daheim war und den andersfarbigen Flügel entdeckte, eine Diskussion, die jedoch mit heftigen Umarmungen rasch ausklang.
Neben seinen kaufmännischen Aktivitäten spekulierte Adlerico nicht ungern an der Börse. Machte er, was gar nicht so selten der Fall war, Gewinne, wurde, fast könnte man sagen, übermäßig gelebt. Er überhäufte seine Gattin mit sehr, sehr viel Schmuck und wertvollen Teppichen. Es ging ihnen ausgezeichnet. Nebenher war Adlerico stiller Teilhaber einer Wiener Klavierfabrik. Auch war er an einer italienischen Versicherungsgesellschaft mit einem beträchtlichen Aktienpaket beteiligt.
Als gut aussehender, sprachgewandter Kaufmann mit weltmännischem Auftreten bevorzugte er es, sich mit der großen Familie stets da niederzulassen, wo sich auf längere Zeit hinaus gute Geschäfte machen ließen. Zur großen Familie zählten stets seine Mutter Lea und seine jüngeren Schwestern Dorothée und Fridica. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie für Monate Wien verließen. Die Wiener Wohnung behielten sie stets. Ihre Zelte aber schlugen sie in den verschiedensten Gegenden Jugoslawiens auf. Das waren Städte wie z. B. Skopje, Belgrad und Thessaloniki [2]. Ihre Kinder besuchten die Schulen stets dort, wo sie sich niederließen. Somit wuchsen jene mehrsprachig auf.
Dann kam das Jahr 1938. Wieder einmal waren sie in Wien ansässig und urplötzlich von vielen Freunden und Bekannten „die Juden“ genannt worden. Von Tag zu Tag wurde es krasser. Vom Innenhof des Hauses in der Liniengasse Nr. 40 wurden sie mit antisemitischen Parolen angepöbelt. Um den Mob ruhig zu halten, entschied sich die verängstigte Elfriede, so manches lieb gewordene Schmuckstück nach unten zu werfen. Adlerico und Elfriede schien es nun angebracht, sich mit allen Angehörigen rasch nach Jugoslawien abzusetzen. In Österreich nahmen die Judenverfolgung und die Arisierung immer größere wie auch schlimmere Ausmaße an. Mit der „Reichskristallnacht“ [3] war ihre Abreise aus Österreich endgültig beschlossen.
Jugoslawien kannten sie durch ihre oftmaligen Aufenthalte ausgezeichnet. Das Land war ihnen seit längerer Zeit zur zweiten Heimat geworden. Es schien ihnen die nötige Sicherheit vor Hitler und dessen unzähligen Schergen bieten zu können. Doch es schien nur so. Bald marschierten die Nazideutschen, ihrem Leitlied „Heute gehört uns Deutschland, und morgen die ganze Welt“ [4] folgend, auch in Jugoslawien ein. [5] Nun mussten sich alle Gamliels selbst hier zu verstecken versuchen. Mit so vielen Personen war dieses Unterfangen mehr als schwierig und auf Dauer nicht machbar. Eine Zeit lang gelang es ihnen. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Gaston, Dorotheas jüngerer Bruder, trank verseuchtes Wasser. Er erkrankte an Typhus. Sich verborgen zu halten, dabei für den schwer erkrankten Sohn ärztliche Hilfe zu bekommen, wurde immer schwieriger, zuletzt unmöglich. Die Deutschen rückten näher und näher. Truppen waren schon in unmittelbare Nähe gekommen. Immer öfter, meist bei Nacht, mussten die Gamliels ihre Verstecke wechseln. Gaston, der hochbegabte, intelligente Sohn, konnte ausgezeichnet zeichnen und malen. Auch schuf er Gedichte, die er mit kunstvoller Schrift niederzuschreiben verstand. Sein stechend scharfer Blick hatte eine große Ähnlichkeit mit jenem von Franz Kafka [6]. Gaston durfte nur achtzehn Jahre alt werden. Der genannten Widrigkeiten wegen „durfte“ er an Typhus sterben und wurde nicht, wie die meisten seiner Verwandten, in der Gaskammer umgebracht. Seine letzte und ewige Ruhestätte fand er am jüdischen Friedhof in Thessaloniki.
Gastons Tod war ausschlaggebend für den darauf folgenden Zusammenbruch seiner Eltern, besonders für den seiner Mutter. Sein Tod schattierte somit das Todesurteil für den Großteil der weiteren Familienangehörigen voraus. Adlerico und Elfriede konnten und wollten nicht mehr gegen ihre Verfolger ankämpfen, andauernd flüchten und sich verstecken. Wie Dorothea schon länger davor, hatte sich auch Dorothée (Adlericos Schwester) zum Glück instinktiv von der Großfamilie abgesondert. Dorothée verliebte sich während der Flucht in einen jugoslawischen Juden. Sie bekam eine Tochter, die Editha genannt wurde. Irgendwie, sicher abenteuerlich – wenn man es in dieser Situation so nennen darf –, gelang es dem Trio, sich bis nach Palästina durchzuschlagen.
Alle anderen Familienmitglieder, angefangen von der greisen Amama Lea bis hin zum zweijährigen Mischa, dem Sohn Fridicas, der jüngeren, zudem hochschwangeren Schwester Adlericos und deren Gatte Avram, wurden von der Gestapo gefasst. Am 11. März 1943 (laut Israelitischen Kultusgemeinde Bitola) [7] wurden sie nach Polen in ein Konzentrationslager in Treblinka deportiert und kurz danach vergast.
Dorotheas Mutter Elfriede hatte in Wien eine Schwester. Jene hieß Andrea und war mit Karl August Haas, einem selbstständigen Handelsangestellten, seit 1933 verheiratet. 1937 ließ er sich von den Zeugen Jehovas taufen und nahm bis 1938 regelmäßig an Bibeltreffen teil. Nach der Besetzung Österreichs erfolgte im Mai 1940 seine Einberufung zum Deutschen Militär. Dieser widersetzte er sich, versteckte sich in einem Gartenhäuschen, wo er jedoch bald entdeckt und festgenommen wurde. Ab dem 15. Oktober 1941 musste er im Wiener Militärgefängnis vorläufig gesiebte Luft atmen. Am 11. Jänner 1942 wurde er von Wien nach Berlin, Alt-Moabit verlegt und am 5. März vom 2. Senat des Reichskriegsgerichts zum Tode verurteilt. Um das Todesurteil zu vollstrecken, wurde Karl Haas von Berlin nach Brandenburg-Görden [8] überstellt, wo man ihn am 11. April 1942 mittels Fallbeil hinrichtete. [9]
Seine Witwe Andrea war damals eines der ersten weiblichen Wesen in der Stadt, das den Führerschein für LKW-Fahrzeuge machte. Auch sie wurde im Herbst 1940 wegen Verbrechen nach § 3 der Verordnung vom 23. November 1939 zum Schutze der Wehrkraft des Deutschen Volkes (Beistandsleistung an dem Militärflüchtling Karl August Haas, ihrem Ehegatten) ins Wiener Polizeigefängnis gebracht. Sie wurde am 5. Dezember 1941 zu eineinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt und am 19. Jänner 1942 ins Frauenzuchthaus Aichach [10] überstellt, wo sie bis 1. Mai 1942 inhaftiert blieb. Ihrem Karl hielt Andrea über dessen Tod hinaus ihr ganzes Leben lang die einmal vor dem Traualtar versprochene Treue.
Derweil war Dorothea in der ihr wohl bekannten Fremde auf sich alleine gestellt. Schon längere Zeit war der Kontakt zu ihren Eltern der Kriegszustände wegen abgebrochen, ließ sich auch nicht mehr herstellen. Sie schlug sich zu Freunden in die Nähe Belgrads durch, immer auf der Hut, nicht als Österreicherin und schon gar nicht als Jüdin entlarvt zu werden. Sie war sich bewusst, dass sie jeder, nicht nur fremden, Person auf Leben und Tod ausgeliefert war. Es waren Serben, bei denen sie Unterschlupf und Schutz fand. Bei denen konnte sie deren Kinder beaufsichtigen und ihnen in schulischen Belangen behilflich sein. Diese Familie hatte einen Sohn, der etwas älter als Dorothea war. Ob sie sich in einer verzwickten Situation befand, gar erpresst wurde, oder ob es Zuneigung war, ist nicht bekannt. Jedenfalls hatten Dorothea und er ein nachhaltiges Verhältnis miteinander angefangen. Im Körper der Zweiundzwanzigjährigen begann ihr Sohn Hans zu entstehen.
Zwei Jahre danach, Dorothea lebte längst nicht mehr bei jener Familie, jedoch nach wie vor als „U-Boot“ [11] getarnt in Belgrad, schenkte sie am 21. November 1942 einer Tochter das Leben. Der Vater des Mädchens Erika war ein Wiener Polizist. Er hieß Otto B. und war, nachdem er zum deutschen Militär eingezogen worden war, nach Jugoslawien versetzt worden. Wie und wodurch sich Dorothea und der Polizist kennenlernten, wurde von deren Kindern, wie so vieles mehr, leider nie hinterfragt. Weder bei Hans noch Erika kam je das Interesse auf, ihrer Mutter danach Fragen zu stellen, selbst als beide erwachsen waren. Es könnte die Wiener Sprache gewesen sein, die den Polizisten und Dorothea fern der Heimat zusammengeführt hatte. Kurz vor ihrer Niederkunft wurde sie bei einer der häufig erfolgten Razzien mitgenommen und in ein Belgrader Gefängnis gesteckt. Zwischen Partisaninnen und Prostituierten brachte sie Erika zur Welt. Bis Dorotheas falsche Papiere als echt befunden wurden, musste sie in Haft bleiben. Während dieser Zeit halfen ihre Mitgefangenen eifrig, ihr Baby, so gut wie es unter den Umständen machbar war, zu versorgen. Die feuchten Windeln trockneten sie, indem sie diese fest an ihre warmen Körper pressten. Vermutlich war der Wiener Polizist Dorothea wegen der gemeinsamen Tochter irgendwie behilflich, rascher aus der Haft entlassen zu werden? Sicher trugen die ausgezeichnet gut gefälschten Papiere wie auch der Umstand, dass sie die Landessprache perfekt beherrschte und außer mit dem Wiener Polizisten zu keiner Zeit ein Wort deutsch sprach, dazu bei. Sowie sie entlassen wurde, tauchte sie anderswo unter, um sich von der überstandenen Geburt und den ausgestandenen Ängsten halbwegs zu erholen. Hans war über diese Zeit bei serbischen Freunden untergebracht.
Viel zu lange dauerte die Hitlerzeit und viel zu langsam ging sie dem Ende entgegen. Schon schrieb man das Jahr 1945. Bei Dorothea begann sich an einer Halsseite eine Geschwulst, ein Ödem, zu bilden, welches zuletzt Kinderkopfgröße erreicht hatte. Ein operativer Eingriff wurde unumgänglich. Man brachte sie in ein nahe gelegenes deutsches Lazarett, und das, während rundum die Kämpfe gegen die anrückende Sowjetarmee immer heftiger wurden. Obschon der Gefechtslärm von Mal zu Mal deutlicher zu vernehmen war, wurde Dorotheas Operation in Angriff genommen. So angstvoll sie sich unter das von einem Deutschen geführte Skalpell begab, so erstaunt und überglücklich war sie, als sie nach dem erfolgreich ausgeführten Eingriff erwachte. Jetzt war sie nicht mehr von deutschen, sondern von russisch und serbisch sprechenden Medizinern umgeben. Von übergroßem Glücksgefühl erfasst und in der Gewissheit, dass sie in jeder Hinsicht endlich gerettet war, weinte und schluchzte sie unaufhörlich vor sich hin. Der fürchterliche Krieg, die Verfolgung, das Frieren und das Hungern waren endlich vorbei. Sie musste nicht mehr Stunde um Stunde, tagtäglich, Monate, nein, Jahre lang um ihr Leben und das ihrer Kinder zittern. Die deutschen Besetzer wurden immer weiter zurückgetrieben und letztlich geschlagen und alsbald der Krieg in Jugoslawien offiziell als beendet erklärt. Für Dorothea war es nun vorrangig, mit den Kindern in die Heimat nach Österreich, im Besonderen nach Wien, zu gelangen. Wo sich ihre anderen Familienmitglieder aufhielten, davon hatte sie keinerlei Ahnung. Die Wahrheit, die schreckliche Wahrheit, sollte sie erst später erfahren. Jetzt hieß es für sie irgendwie zu versuchen, mit den gefälschten Papieren die schwer gesicherten Grenzen zu passieren.
2. Heimkehr mit vielen Hindernissen
Nachdem sie sich und die Kinder an der Grenze zu Österreich als Wienerin und Jüdin ohne jedwede authentische Dokumente deklarierte und anstatt nichts die sehr gut gefälschten jugoslawischen Papiere vorgewiesen hatte, wurde sie verständlicherweise vom englischen Militär für sechs Tage im Bezirksgericht in Leibnitz zu sechs Tagen Arrest verurteilt. Die gefälschten Papiere waren ihr abgenommen worden. Nach den sechs Tagen Haft musste sie jetzt versuchen, ohne jegliche Papiere zu besitzen, weiter durch verschiedene militärische Besatzungszonen Österreichs nach Wien zu gelangen. [12] Dies alles mit zwei Kleinkindern im Schlepptau und dem Kopf voll mit Erinnerungen der erst kurz zu Ende gegangenen, schrecklichen Vergangenheit beladen. Wie oft schon davor gelang Dorothea auch dieses Unterfangen. Sie war eine Meisterin der Improvisation.
Die erste Station, an der sie mit den Kindern anlangte, war das Schloss Neuhaus im Bezirk Ried im Innkreis in Oberösterreich. Hier waren bereits andere Kinder, vermutlich Waisen, untergebracht. Zum Schloss, das auf einer Anhöhe lag, führte ein steiler Weg hoch. Manchmal durften Kinder mit dem Gutsknecht, der ein aus zwei Apfelschimmeln [13] bestehendes Pferdegespann führte, diesen steilen Weg mit hochfahren. Hans genoss dieses Erlebnis. Die beiden Rösser mussten sich mächtig ins Zeug legen, um den Holzkarren und die aufgebürdete Last hochzuziehen. Dies spielte sich unmittelbar bei Kriegsende ab. Stets dann, wenn der Lärm von Flugzeugmotoren hörbar war, wurden alle Kinder von den Tanten rasch in den an das Schloss angrenzenden Wald geschickt, um verstecken zu spielen. Das wurde so lange praktiziert, bis der Flugzeuglärm verklungen war. Danach durften sie zum und ins Gebäude zurückkommen. Der Aufenthalt auf Schloss Neuhaus war von kurzer Dauer. Zu sehr drängte es Dorothea nach Wien und danach, endlich etwas über den Verbleib ihrer Angehörigen zu erfahren, was sich noch eine Weile hinziehen sollte.
Es bleibt ein Rätsel, wie sie es schaffte, von Ried im Innkreis in die Landeshauptstadt der Steiermark zu gelangen. In Graz angelangt, erfuhr sie von der Existenz des „Joint“ [14]. Das war eine amerikanische Institution, die Juden Hilfe leistete. An jene wandte sie sich. Der „Joint“ quartierte sie mit ihren Kindern im kleinen Hotel „Schimmel“ ein und kam für die Logiskosten auf. Hans befand sich im fünften, Erika im dritten Lebensjahr. Das Hotel, in welchem man ihnen eine Bleibe zugewiesen hatte, befand sich nicht unweit vom Grazer Opernhaus. Einige Hotelgäste waren Künstler, die an diesem Opernhaus beschäftigt waren und für die Dauer ihres Engagements gleichfalls im Hotel Schimmel logierten. Die berühmtesten Namensträger unter ihnen waren die Opernsängerin Cebotari [15] und der Filmschauspieler Diessl [16]. Ein weiteres Paar waren die Operettensänger Walter und Melitta Gaster. Dann noch die Tichovs, ein Ehepaar, welches eine Tochter, die Mimi hieß, hatte und Bulgaren waren. Der Vater war ebenfalls Opernsänger. Mimi war gleich alt wie Hans und dessen Spielgefährtin. Ab und zu, wenn Hans bei den Tichovs zugegen war, konnte er Herrn Tichov die Tonleitern hinauf und hinunter singen hören. Mit beiden Gasters war Dorothea eine engere Freundschaft eingegangen. Sie sprachen viel über Gesang und Musik im Allgemeinen, war doch Dorothea vor Kriegsausbruch bei dem bekannten Wiener Opernsänger Hans Duhan [17] in Gesangsausbildung gewesen. Die Gasters adoptierten einen Waisenknaben. Nach dem frühen Tod von Herrn Gaster übersiedelte seine Witwe mit ihrem Adoptivsohn nach Wien, wo sie Engagements in Operetten- und Märchenaufführungen fand. Häufig trat sie im Dianakino in der Praterstraße auf. Dieses Kino war so gebaut und dementsprechend eingerichtet, dass es sich auch für kleinere Theateraufführungen sehr gut eignete. In Wien lernte Melitta Gaster einen wesentlich älteren Herrn kennen. Er war Häusermakler und umwarb Melitta sehr. Schließlich heirateten sie. Das Eheglück war leider nicht von langer Dauer. Melittas neuer Gatte verstarb nicht lange nach der Hochzeit. Von da an blieb sie, als bestens versorgte Witwe, mit Adoptivsohn und ererbtem Vermögen alleine. Seit Melittas zweiter Eheschließung hatte sich das freundschaftliche Verhältnis zu Dorothea merklich abgekühlt gehabt. Mit einem Mal erlosch es ganz. Melitta hatte davor Angst, von Dorothea um etwas angebettelt zu werden. Dabei hatte sie Dorotheas Charakter nicht erkannt, der solches niemals in den Sinn gekommen wäre.
Die Namen Cebotari und Diessl waren vielen Menschen ein Begriff. Sie waren miteinander verheiratet und gaben ein reizendes Ehepaar ab. DIE Cebotari, eine begnadete, weltweit bekannte Opernsängerin, äußerst attraktiv aussehend, stammte aus Bessarabien (Rumänien). Herr Diessl war Deutscher, sah ebenfalls blendend aus und war Filmschauspieler von Beruf. Im Hotel Schimmel war das Ehepaar noch kinderlos gewesen. Begegnete man einander in der Hotelhalle oder auf dem Korridor, war besonders Herr Diessl von Erika sehr angetan. Er unterließ es dann nie, die kleine Blondgelockte in seine Arme zu nehmen, hochzuheben und zu liebkosen. Wenige Jahre danach, sie waren nach England übersiedelt, war dem Ehepaar das vollkommene Glück beschieden. Sie waren Eltern von zwei Knaben geworden. Leider wurden die Buben noch im Kindesalter zu Vollwaisen. Innerhalb kurzer Zeitabstände verstarben beide Elternteile viel zu jung und zu früh. Diese erschütternde Begebenheit hatte darüber hinaus noch ein trauriges Nachspiel. Nach dem Tod des Künstlerehepaares wollte sich deren langjährige Haushälterin um die beiden Knaben und deren Erziehung weiterhin sorgen und sie sogar adoptieren. Die örtlichen Behörden entschieden jedoch gegen das Ansinnen der Frau und entzogen die Waisenknaben ihrer Obhut. Dies nahm sich die Frau dermaßen zu Herzen, dass sie sich das Leben nahm.
Noch in Graz weilend, erhielt Dorothea öfters Freikarten zu Operettenaufführungen, in welchen die Gasters mitwirkten. Hin und wieder nahm sie Hans als Begleitung mit sich. Hans verstand, auch wenn seine Mutter ihm dies und jenes zu erklären versuchte, kaum oder überhaupt nichts davon. Von den herrlichen Melodien blieb in ihm jedoch sehr viel haften. Mit der Mitnahme ihres Sohnes versuchte sie ihre grenzenlose Liebe zu guter Musik auf Hans zu übertragen, was ihr auch bestens gelungen ist. Erika, die zum Mitnehmen und Verstehen der Vorführungen noch zu klein war, wurde derweil bei Frau Tichov im Hotel zurückgelassen.
Hans wurde nicht nur zu Operettenaufführungen, sondern auch auf Hamstertouren mitgenommen. Gehamstert wurde jeweils zu Abendzeiten. Hamstern bedeutete, sich im Tauschhandel oder gegen harte US-Dollar, so man welche besaß, bei Bauern auf dem Lande Nahrungsmittel zu beschaffen. Diese Art Handel war verboten, doch hielt dies kaum jemanden davon ab. Vermutlich wurde der Knabe zwecks Tarnung mitgenommen.
Nach wie vor in Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs, lebend, lernte Dorothea einen gleichaltrigen Mann kennen. Er, ein waschechter Steirer, hatte rotblondes Haar wie sie und hieß Anton Schober. Eben erst war er aus der Sowjetunion vom „Kampf“ und anschließender Gefangenschaft zurückgekehrt. Beide achtundzwanzig Jahre alt, fanden sie sich sympathisch und fassten den Plan, gemeinsam ihre neu beginnenden Leben in Angriff zu nehmen, meinten, es auch meistern zu können. Sie träumten – wen wundert es – und glaubten an das zukünftige Glück. Deshalb wurde alsbald geheiratet. Doch schon ein halbes Jahr nach dem eingegangenen Bund fürs Leben war ihre Ehe in die Brüche gegangen. Dass das Scheitern dieser Ehe seine Mutter bedrückt hatte, sie deshalb sehr viel weinte, blieb Hans lange in Erinnerung. Blickte er in späteren Zeiten darauf zurück, so meinte er, dass der fesche Grazer nicht der rechte Lebenspartner für seine Mutter gewesen war. Das Einzige, was dem damals knapp Fünfjährigen von jenem Mann gelehrt worden war, war, wie er sich auf dem WC den Hintern mit zurechtgerissenem Zeitungspapier säubern könne. Er solle, so lautete dessen Ratschlag, dieses vor Gebrauch arg zerknüllen. Zwischen den Ehepartnern hatte ein zu großer geistiger Unterschied bestanden. Das Positive an der Trennung war, dass sich Dorothea umgehend daran machte, mit den Kindern auf allerschnellstem Weg nach Wien zu gelangen.
Während der ganzen Zeit, in der sie sich nun wieder in Österreich aufhielten, nutzte Dorothea jede Möglichkeit, um an Nachricht über ihre Angehörigen zu gelangen. Sie nahm an, dass jene sich immer noch, wenn auch verstreut, in Jugoslawien aufhielten. Ihre Nachfragen waren stets vergeblich, niemand konnte ihr darüber Auskunft geben.
Endlich waren sie, unzählige Hindernisse umgehend und überwindend, in Wien in Dorotheas Geburtsstadt angekommen. Die ersten Tage fanden sie bei Bekannten Dorotheas, besser gesagt deren Eltern, Unterkunft. Auf Dauer war dies keine Lösung. Dorothea suchte ihre Tante Andrea, deren Mann man in Brandenburg-Görden umgebracht hatte, auf. Für kurze Zeit konnten sie bei dieser bleiben. Natürlich wurde auch sie gefragt, ob sie Nachricht von den anderen Familienmitgliedern hätte, was jene verneinte. Tante Andrea hatte noch während des Krieges ein Mädchen, welches Adele hieß, als Ziehtochter zu sich aufgenommen. Obschon es sich um die vor dem Krieg gemietete Wohnung von Dorotheas Eltern handelte, war diese nun für sie alle zu klein geworden. Die einst riesige Wohnung war arisiert und in zwei Wohnungen umgewandelt worden. Sowie die Gamliels geflüchtet waren, waren arische Mieter einquartiert worden.
Nebenher hatte Dorothea von der wieder existierenden Jüdischen Kultusgemeinde vernommen und ist dort umgehend vorstellig geworden. Sie hatte erfahren, dass Juden dort geholfen werde. Zudem könne man über vermisste Angehörige gezielte Nachforschungen anstellen. Sie machte sich auf den Weg dahin. Im dort eingerichteten Büro konnte sie jedoch alle geforderten Informationen nur mündlich angeben. Wenige Wochen danach wurde ihr die schreckliche Mitteilung gemacht, dass außer ihrer Tante Dorothée, die noch von Jugoslawien aus mit ihrer Tochter Editha nach Israel flüchten konnte und seither dort beheimatet ist, alle weiteren Familienangehörigen vergast worden waren. Das war der fürchterlichste Tiefschlag im noch so jungen, mit dermaßen schlimmen Ereignissen gespickten Leben Dorotheas. Trotz allem, gegenüber ihren innig geliebten Kindern verstand sie es meisterlich ihren Gemütszustand zu verbergen. Er sollte sie aber fortan gesundheitlich, besonders ihr Herz betreffend, zeichnen. Welche ungeahnten Kräfte und welche Größe steckten in dieser so leidgeprüften Mutter? In späteren Zeiten erzählte sie nicht nur ihren Kindern, dass eben diese beiden ihr größtes Glück waren. Nur diese hätten ihr die Kraft, vor allem den Willen zum Weiterleben gegeben. Ohne ihre so sehr geliebten Kinder hätte sie dieses Leben weder durchstehen können noch wollen.
Unmittelbar nach der ersten Vorsprache bei der Kultusgemeinde in Wien wurde ihnen eine Bleibe im jüdischen Obdachlosenheim zugewiesen. Das Heim befand sich in der Leopoldstadt, dem zweiten Wiener Gemeindebezirk, in der Tempelgasse im Haus Nummer 3. Dorothea war unsagbar müde, doch sehr froh, endlich eine Unterkunft zugewiesen bekommen zu haben, welche sie nicht schon nach wenigen Tagen wieder verlassen mussten.
3. Das Heimleben
Das Heim, ein dreistöckiges Backsteingebäude, steht noch heute, inzwischen renoviert und innen teilweise umgebaut. Es grenzte, durch einen langen Hof getrennt, an die Ruine des von den Nazihorden zerstörten Tempels [18]. Sowie Dorothea mit ihren Kindern von der Heimleiterin, sie hieß Frau Citron, empfangen und aufgenommen worden war, wies diese dem sechsjährigen Hans das letzte freie Bett in einem von Männern bewohnten Raum zu. In jenem waren ausschließlich alte, zum Teil psychisch krank gewordene Männer untergebracht. Inmitten dieser Verbitterten bezog der Knabe die ihm zugewiesene Bettstatt. Alle Betten waren aus weiß emaillierten Eisenrohren gefertigt. Voneinander waren sie durch Nachtkästchen, aus ebensolchem Material bestehend, getrennt. An vielen Stellen, sowohl der Betten als auch der Nachtkästen, war die Emailschicht teilweise abgesplittert. Dies ließ nicht nur aufs Alter, sondern auch auf deren Behandlung durch oftmaliges Umherschieben und Anstoßen schließen.
Manche Mitbewohner sah Hans nur am Abend, wenn sie zum Schlafen ins Heim zurückkamen. Tagsüber waren sie weg. Ein Mann verließ sein Bett wiederum fast nie. Gesprochen wurde miteinander kaum ein Wort. Zu sehr war jeder mit seinen durch die Nazis entfachten Problemen und der schrecklichen, erst kürzlich zu Ende gegangenen Vergangenheit beschäftigt. Bei allen Heimbewohnern hatte es den verständlichen Anschein, als hüte sich jeder davor, einen anderen über die zurückliegenden Jahre und dessen Überleben zu befragen, geschweige überhaupt darüber zu diskutieren. Jeder meinte von sich, dass nur er das Schrecklichste er- und überlebt habe. Andererseits und zugleich fürchtete jeder sich, noch Grausameres geschildert zu bekommen und damit in seinem Schmerz übertroffen zu werden. So lebte man eine Zeitlang auf allerengstem Raum wohl gemeinsam, jedoch gewollt aneinander vorbei. Ab und zu stritten Männer aus nebulösem Grund miteinander. Da war einem Mann die Zimmerluft zu stickig, weshalb er sich zum Fenster begab und es öffnete. Einem anderen Mann wurde die einströmende Zugluft unerträglich, und schon ging der Disput los.
An einer Wandseite des Zimmers stand ein breiter, weißer Kasten. Er war zur Benutzung für alle diesen Raum Bewohnenden bestimmt. Da niemand etwas zum Hineinhängen oder Hineinlegen besaß, blieb er unbenutzt. Der Einfachheit und vermutlich auch der Faulheit halber wurden die Kleider, die man tagsüber trug, abends über das Bettende gehängt oder direkt neben sich auf dem Nachtkästchen abgelegt. Dementsprechend unordentlich sah es in dem Zimmer aus. Es störte sich aber niemand daran.
Hans war aufgefallen, dass sich einer der Männer gar mit den Kleidern, die er tagsüber trug, zu Bett legte. Ein anderer, dessen Oberlippe ein dicker, schwarzer Schnurrbart à la Nietzsche [19] zierte, lag andauernd in seinem an die Wand anstoßenden Bett. Er hustete häufig und mehr als lautstark. Zudem hatte er die schamlose Angewohnheit – vermutlich mochte oder konnte er sich nicht mehr anders verhalten –, seinen wahrscheinlich tuberkulösen Schleim ebenso lautstark hervorzuhusten und diesen auf ein unter seinem Bett ausgebreitetes Papier, welches er mit einer Hand hervorzog, auszuspucken.
Dorothea und Erika landeten in einem Zimmer, welches mit Frauen belegt war. Wenige Wochen danach wurde Dorothea ein frei gewordenes Zimmerchen zugewiesen, in welchem sie nun auch Hans unterbringen konnte. Nun waren sie nicht mehr voneinander getrennt. Dieses winzige Zimmer konnten sie jedoch nur verlassen oder erreichen, indem sie ein von Männern bewohntes durchschreiten mussten. Auf Dauer wurde dies aus verständlichen Gründen untragbar.
Dadurch, dass es ausschließlich nur in den Stiegenhäusern und in den Gemeinschaftsküchen fließendes kaltes Wasser zu beziehen gab und sich die Etagenklosetts außerhalb der Zimmer befanden, war es unvermeidlich, dass mal dieser, mal jener ein Bedürfnis zu erledigen hatte und das Zimmer deshalb verlassen oder wieder betreten musste. Dies waren die Gründe, weshalb sich Spannungen aufluden. Diese stauten sich mehr und mehr auf, bis sie sich schlussendlich unverständlicherweise in Schimpftiraden entluden. Ehe diese zu Exzessen ausarteten, wurde die Heimleitung gefordert, eine für alle befriedigende Lösung auszuarbeiten.
In solchem Fall begann Frau Citron hastig und so gut sie es vermochte und es die tristen Gegebenheiten zuließen umzuquartieren. Abermals wurde Dorothea ein anderes winziges Zimmer mit ähnlich gearteten Problemen zugewiesen. Auch bei diesem mussten sie, um es zu erreichen oder zu verlassen, ein anderes Zimmer durchschreiten. Hier wurden sie nicht der Störung bezichtigt. Die Bewohner des zu durchschreitenden Zimmers waren Frauen. Es waren Frau Adler, eine alleinstehende Rumänin, dann die gleichfalls alleinstehende Altösterreicherin Frau Goldberger und Frau Rosenberger mit ihrer Tochter Hanni, die Ungarinnen waren. Hanni war auf den Tag genau ein Jahr älter als Hans. Mit Frau Adler hatte Hans nur dann Kontakt, wenn diese die Absicht hatte, sich Kaffee zu kochen. Diesen bereitete sie immer frisch, und zwar auf türkische Art, so wie sie es aus ihrer Heimat her kannte und gewohnt war, zu. Sobald ihr danach war und sich Hans in der Nähe aufhielt, ersuchte sie ihn, so nett zu sein und ihr die mühevolle Arbeit des Mahlens der Kaffeebohnen abzunehmen. Hans tat ihr jedes Mal den Gefallen. Er nahm die orientalische, messingbeschlagene, reichlich ziselierte, runde, dünne Kaffeemühle in die eine Hand und mühte sich ab, die Kurbel mit der anderen Hand gleichmäßig zu drehen. Diese Tätigkeit verlangte dem Knaben einen ordentlichen Kraftaufwand ab. Dies ließ er sich nicht anmerken, auch wenn’s beim Drehen hin und wieder stockte oder sich nur ruckartig weiterdrehen ließ. Die sich in der Mühle befindlichen, sehr dunkel gerösteten Kaffeebohnen wurden fein zu dunkelbraunem, mehlartigem Pulver gemahlen. Waren die Bohnen fertig gemahlen, bedankte sich Frau Adler und begab sich umgehend in die Gemeinschaftsküche, wo sie ihren geliebten türkischen Kaffee in einem ebensolchen Kännchen mit langem Stiel aufzukochen begann.
Es gab kein Zimmer im Heim, welches nicht von Ungeziefer, hauptsächlich von Wanzen, befallen war. Um gegen diese Plage anzukämpfen, besorgte sich Dorothea das zu jener Zeit hochgelobte und mittels vieler Plakate angepriesene DDT, ein, wie darauf propagiert, wirksames Insektenvernichtungsmittel. Dieses wurde als Pulver in kleinen runden, nach außen hin leicht gewölbten Kartondosen in Drogerien und Apotheken verkauft. Um es zu benutzen, musste man in einen markierten Punkt seitlich ein nageldünnes Loch stechen. Durch leichtes Zusammendrücken der Kartondose schoss aus dem Loch das Pulver dahin, wohin man es gerichtet hatte. Dies zu tun wurde Hans beauftragt. Wo immer im Zimmer Ritzen oder Löcher sichtbar waren, durfte er sich daran machen, jene mit dem Pulver zu bestreuen. An manchen Wänden zogen sich kreuz und quer schmale bräunliche Streifen. Diese waren einst rot gewesen und stammten von zerdrückten Wanzen, denen Vorbewohner des Zimmers, die noch kein Pulver besaßen, den Garaus gemacht hatten. Das hochgiftige Pulver half tatsächlich ausgezeichnet, ohne an den Wänden weitere unschöne Spuren zu hinterlassen.
Eine der wenigen noch intakten Familien, die im Heim untergebracht waren, hieß Persak. Es war ein Ehepaar mit zwei Kindern, Lotte und Peter. Die Familie durfte sich glücklich schätzen. Herr Persak hatte im Innendienst der Polizeidirektion Beschäftigung gefunden. Dadurch hatte die Familie, wenn auch nur ein geringes, so doch regelmäßiges Einkommen, mit dem sie recht gut über die Runden kommen konnte. Lotte, die etwa gleich alt wie Hans war, spielte gerne mit ihm und Erika. Zeitweilig waren sie die einzigen Kinder unter den vielen, hauptsächlich alten Bewohnern. Lotte spielte am liebsten Familie, also Vater, Mutter und Kind. Das spielte sie oft, sehr leidenschaftlich und so lange wie möglich. Hans, den dieses Spiel auf Dauer zu langweilen begann, sonderte sich regelmäßig nach einer Weile ab und ließ die restliche Familie „sitzen“. Das Glück war der Familie Persak holder als der Familie Gamliel, sie konnten bald aus dem Heim in eine Gemeindewohnung am Schöpfwerk in den zwölften Bezirk übersiedeln.
Sowie Dorothea und die Kinder im Heim heimisch geworden waren, hatte Hans sich die Tempelruine als bevorzugten Aufenthaltsort auserkoren. Dabei war ihm mit seinen sechs Jahren keineswegs bewusst, wie lebensgefährlich das Spielen in und auf der „Reichskristallnacht-Ruine“ war. Er erzählte seiner Mutter nicht, wie magisch ihn die schummrigen Abteile der Ruine anzogen. Auf den eingestürzten, größtenteils rußgeschwärzten Balken und Schuttbergen, aus welchen noch verkohlte und zerfetzte Gebetbücher und Gebetstücher hervorsahen, ließ es sich toll herumklettern und dabei der kindlichen Phantasie freien Lauf lassen. Hin und wieder huschten Ratten, von denen er sich keineswegs stören ließ, an ihm vorbei. Er konnte sogar noch zerborstene, arg verkohlte Sitzbänke ausmachen, die da und dort nicht völlig von Schutt bedeckt umherstanden. Hätte seine Mutter von seinem Treiben gewusst, sie hätte es ihm augenblicklich ein für alle Mal untersagt.
Einmal kam es vor, dass er von einem Passanten beim Umherklettern auf der Ruine beobachtet und angesprochen wurde. Der Mann ersuchte Hans, ihm doch eine Jungtaube aus einem der vielen Nester für sich daheim herunterzuholen. Hans war es seiner unbekümmerten Jugend wegen nicht in den Sinn gekommen, dass es sich bei dem Bittsteller mit allergrößter Gewissheit um einen Hungernden handelte, der diese Taube daheim umgehend zu verspeisen gedachte. Hans ging es vielmehr darum, seine Kletterkünste zu zeigen. Deshalb kam er solcher Bitte nicht nur einmal gerne nach.
Irgendwann erinnerte sich Dorothea daran, dass ihr geschäftstüchtiger Vater unter anderem auch stiller Teilhaber einer kleineren Wiener Klavierfabrik gewesen war. Sie hegte gewisse Hoffnung, und eines Tages begab sie sich, Hans mit sich an der Hand führend, auf den Weg zu dieser Fabrik. Diese befand sich in einem der Innenbezirke Wiens. Dort angekommen, gelang es ihr, mit dem Geschäftsführer ins Gespräch zu kommen und die Geschichte ihres Vaters vorzubringen. Unwillig hörte jener zu. Als Dorothea fertig gesprochen hatte, lautete dessen Antwort, lakonisch im Wiener Dialekt ausgesprochen: „Hab’n Sʼ was in da Hand, als Beweis?“ Der Ausgang dieses Dialoges war für Dorothea niederschmetternd. Danach nahm sie sich vor, keine weiteren Nachforschungen nach Eigentum welcher Art auch immer mehr anzustellen.
Hans und Erika wuchsen ohne leiblichen Vater auf. Diesen Umstand empfanden sie anderen Kindern gegenüber, die beide Elternteile hatten, keineswegs als Nachteil. Ihre Mutter verstand es aufs Perfekteste, mittels ihrer übergroßen Liebe und Fürsorge, die sie in absolut gleichen Maßen an beide Kinder verteilte, selbst unter widrigsten Gegebenheiten Gedanken an ein Vatermanko niemals aufkommen zu lassen.
Um ins Heim zu gelangen, musste man von der Tempelgasse in den mit Pflastersteinen ausgelegten Hof eintreten. In der Anfangszeit ihres Aufenthaltes war der Hof von der Gasse her frei zugänglich. Einige Quadratmeter der rechten hinteren Hofecke waren von einem flachen Holzdach überdeckt. Dieser Platz wurde von Herrn Breier, einem Tischler, der seine Werkstatt und eine Lagerhalle in zwei im Parterre gelegenen Räumlichkeiten untergebracht hatte, als Abstellplatz für seinen mit zwei großen Rädern bestückten Holzkarren und für die Lagerung langer Holzbretter benutzt. Trat man durch den Hauseingang in den drei, vier Stufen höhergelegenen Flur, konnte man von da weg entweder in die oberen Stockwerke oder hinunter in den stets offen stehenden Keller gehen. Wenige Stufen führten zum finsteren, erdfeuchten Keller, seinen Verzweigungen und dessen vielen, zu beiden Seiten befindlichen Abteilen. Seiner Feuchtigkeit und minimal vorhandenen Beleuchtung wegen blieb er von den Heimbewohnern unbenutzt. Was hätten die besitzlosen Bewohner dort überhaupt deponieren sollen? Wann immer Hans sich in die Kellerabteile begab, fiel sein Blick umgehend auf die alle paar Meter an den Wänden angebrachten und mit roter Schrift und schwarzem Totenkopf bedruckten Zettel. Diese sollten vor ausgestreutem Rattengift warnen.
Eines Tages wurde der Hof mit einem mehr als mannshohen, dicht ineinander gefügten Bretterzaun und ebensolchem Tor, von der Gassenseite her nunmehr uneinsichtig, verbaut. Für das neue Tor bekam jeder Heimbewohner einen Schlüssel. Von der Heimleitung war angeordnet worden, dass das Tor abends ab einer bestimmten Zeit abgeschlossen werden musste. Wie zuvor erwähnt, führten zum Flur im Erdgeschoß drei, vier Stufen hoch, die an einem zweiflügeligen, massiven großen Holztor endeten. Trat man durch dieses, befand sich nach wenigen Schritten zur linken Hand die leer stehende Hausbesorgerwohnung. Diese war zwar klein, jedoch mit einer Kaltwasserleitung, einer kleinen Küche, einem gusseisernen Kohleofen und Innenklosett ausgestattet, was im Heim absoluter Luxus war.
Von hier führten viele Stufen jeweils im Halbkreis zum ersten, zweiten und dritten Stock hoch. Ein mit vielen Verschnörkelungen versehenes gusseisernes Geländer, obenauf mit Holzhalterung abgeschlossen, bot Halt, Stütze und zugleich Schutz. Auf dem Holzabschluss waren, als Verschönerung gedacht, in regelmäßigen Abständen Holznoppen eingearbeitet. Vermutlich dienten sie nicht nur der Verschönerung, sondern auch, um das von Knaben beliebte, aber äußerst gefährliche Hinunterrutschen zu unterbinden. Da altersbedingt bereits mehrere Noppen herausgefallen oder abgebrochen waren, ließen sich Teilstrecken hinabrutschen. Sowie Hans sich unbeobachtet wusste, gab er sich diesem Vergnügen hin.
In jedem Stockwerk war in der Gangmitte an der Wand eine Bassena installiert. Das ist ein gusseisernes, mit ebensolcher Wandhalterung versehenes Wasserbecken, an dessen Oberteil ein Wasserhahn herausragt. Ausschließlich von da und aus den kleinen Gemeinschaftsküchen, von denen ebenfalls in jedem Stockwerk eine vorhanden war, konnte man kaltes Wasser holen. Um sich und ihre Kinder ungestört in den ihnen zur Verfügung gestellten vier Wänden waschen zu können, besorgte sich Dorothea ein altes, weißes, schon arg abgesplittertes, ehemals emailliertes Lavoir und einen ebensolchen Krug. Mit diesen Gefäßen wurde meistens Hans beauftragt, Wasser zu holen. Ein verbeulter Metalleimer, in den jeweils das gebrauchte Wasser geleert wurde, war als Heiminventar im Zimmer vorhanden. In diesen wurde benutztes Wasser geleert. Sobald dieser voll war, wurde Hans – wer sonst – geschickt, diesen im auf dem Gang befindlichen WC auszuleeren.
Von allen drei Stockwerken gelangte man sowohl links wie rechts durch mächtige, immer offen stehende Flügeltüren zu den Zimmern der Bewohner. Die Flügeltüren waren vormals die Eingangstüren zu Feudalwohnungen gewesen, solange bis dieses Haus zu einem Obdachlosenheim für überlebende Juden umfunktioniert werden musste. Vor dem Krieg zählten die Zimmer links wie auch rechts zu Wohnungen für jeweils eine (Groß-)Familie. Jetzt hingegen wurden notgedrungen in jedem vorhandenen Zimmer so viele Menschen wie
möglich untergebracht.
Wegen des großen, nach Kriegsende einsetzenden Ansturmes auf zu wenig vorhandenen Wohnraum konnte die Heimleitung auf vieles keinerlei Rücksicht nehmen. Vielleicht war sie auch überfordert. Da wurden einander völlig fremde Menschen in einem Zimmer, wohl geschlechtlich getrennt, untergebracht, die miteinander weder verwandt noch bekannt waren und häufig aus verschiedenen Ländern stammten, jedoch alle Juden waren. Diejenigen, die nicht aus Österreich stammten und andere Länder als ihr Endziel auserkoren hatten und ihre Unterbringung im Heim nur als notwendigen Zwischenstopp ansahen, konnten es oftmals schon nach kurzer Aufenthaltsdauer wieder verlassen. Daher gab es im Heim immer Bewegung. Sobald die einen abgereist waren, wurden anderen auf einen Wohnraum wartenden Überlebenden die frei gewordenen Plätze zugewiesen.
Unmittelbar hinter den großen Gangtüren befand sich seitlich eine Klosettanlage, pro Stockwerk also zwei. Während die Zimmertüren stets geschlossen waren, standen jene zu den Gemeinschaftsküchen offen. Die Küchen waren in allen drei Stockwerken übereinander angebracht. Von jeder konnte man durch ein kleines, zum Innenhof hinausmündendes Fenster in diesen sehen. Die Sonne konnte draußen noch so hell scheinen, in den Küchen blieb es düster. Jede Küche war mit nur einer, zudem schwach von der Decke herableuchtenden Glühbirne ausgestattet. Betrat man die Küche, standen unmittelbar rechts auf einem Wandtisch jeweils zwei uralte Gasherde, einer mit zwei, der andere mit drei Flammen. Somit standen den Bewohnern je Stockwerk insgesamt fünf Flammen zum Kochen zur Verfügung. Alle Herde waren arg verschmutzt. Der Schmutz rührte von übergelaufenem und nicht weggewischtem Kochgut her. Mit der Zeit hatte sich eine regelrechte Verkrustung gebildet. Kaum ein Benutzer fühlte sich zuständig, die Herde nach Gebrauch zu putzen, und die Heimleitung war es müde geworden, stets kontrollieren zu müssen. An der dem Eingang gegenüberliegenden Wandseite war ein längliches, aus Blech gefertigtes Becken angebracht. Ursprünglich war dessen Verwendung als Geschirrabwaschbecken gedacht, fand jedoch multifunktionelle Verwendung. Mangels anderer Möglichkeiten wurde die Küche von mehreren Bewohnern nicht nur zum Kochen, sondern auch als Waschraum, wenigstens zur minimalen Körperpflege, benutzt. Dies führte nicht selten zu Konflikten, wenn sich jemand waschen, jemand anderer aber kochen wollte. Schlussendlich wurde die Heimleitung herbeigerufen, die schlichtend einschritt und einen Kompromiss aushandeln musste.
Glücklich konnten sich jene nennen, die ein Behältnis besaßen, in welchem sie Wasser holen konnten, um die Waschprozedur in ihrem Zimmer zu vollziehen. Zwar hatten in Wien einige der beliebten Tröpferlbäder [20] wieder den Betrieb aufgenommen, doch konnte sich einen Besuch dorthin keiner leisten.
Die Räumlichkeiten der beiden ersten Stockwerke wurden von der Heimleitung getrennt mit Männern, Frauen und, so überhaupt noch welche bestanden, mit Familien belegt. Ein Eckzimmer, im ersten Stock zur Tempelgasse gelegen, war zu einer Werkstatt für Schuherzeugung umfunktioniert gewesen. Diese wurde vom ursprünglich aus Russland stammenden, sich stets wieselflink bewegenden, weißhaarigen Herrn Rosenkranz sen., den Hans niemals langsam gehen sah, und dessen jüngerem Sohn Kurt sowie einigen männlichen Mitarbeitern und einer einzigen jüngeren Frau, die außer den Rosenkranzʼ alle keine Juden waren, betrieben. Die Familie Rosenkranz selbst wohnte jedoch nicht im Heim. Sie besaßen eine große Wohnung in einem Patrizierhaus in der Taborstraße. Hans und seine Mutter waren einmal von Frau Rosenkranz sen., die karitativ tätig war, zu ihnen auf eine Jause eingeladen worden.
Eine weitere im Heim untergebrachte Familie hieß Cincinati. Sie waren mit ihrem etwa dreijährigen Sohn, der Daniel hieß, jedoch Danusch gerufen wurde, aus Polen kommend im Heim eingetroffen. Auch deren Zimmer war, wie alle anderen, mit Stahlrohrbetten, Nachtkästchen, einem Kasten und einem niedrigen Holzkasten möbliert. Wie viele dem Holocaust Entkommenen, hatten sich auch Danuschs Eltern dadurch einen leichten „Dachschaden“ eingefangen. Besonders fiel einem dies bei Herrn Cincinati auf. Zum Beispiel hatte das Elternpaar panische Angst, sich zu erkälten. Begegnete man ihnen, wunderte man sich, die Familie schon im Hochsommer in Mäntel und Schal gehüllt einhergehen zu sehen. Herrn Cincinatis Tick war so weit fortgeschritten, dass, schien ihm die imaginäre Kälte unerträglich, er sich in den erwähnten kleinen Holzkasten seines Zimmers legte, um sich so vor dem möglichen Erfrieren zu schützen. Hans hatte einmal deren Zimmer betreten, um mit Danusch zu spielen, und dessen Vater wie beschrieben im Kästchen hineingekauert liegen gesehen.
Danuschs Eltern waren bereits in einem fortgeschrittenen Alter, ihr Sohn somit ein Spätling, was dessen Geburt betraf. Mit dem Erziehungsauftrag waren beide Elternteile offensichtlich total überfordert. Die Mutter war dem Dreikäsehoch beim Durchsetzen ihres Willens eindeutig unterlegen. Sie schien dies wohl zu wissen, wusste und suchte jedoch kein Mittel, um dagegen anzukämpfen. Deutlich zeigte sich dies, sobald Danusch essen sollte. Wollte sie ihn mit einer Breispeise füttern – sie kochte ihm immer Breispeisen –, wendete sich der an und für sich kugelrunde Dreijährige von ihr ab und begann davonzuschreiten. Anstatt dem Kind das Hierbleiben zu lehren, begann sie ihm gemächlich nachzutrotten. Mit monotonen, immer gleich lautenden, lockenden Worten gelang es ihr hin und wieder, ihm einen Löffel Brei in den Mund zu schieben. Standen derlei Fütterungen an, sah sie es gerne, wenn Hans dabei war. In diesem Falle wich Danusch nicht von Hans’ Seite. Dies erleichterte ihr das Füttern einigermaßen. Manchen Müttern mag das Hinterherlaufen, wenn es sich um das Füttern ihres Kindes handelt, vielleicht nicht ungewöhnlich anmuten. Frau Cincinatis Fütterungsablauf zog sich jedoch, und dies nicht selten, fast die ganze Praterstraße entlang. Die ist bekanntlich einen Kilometer lang. Selbstredend begann auf solch langen Wegen die Speise regelmäßig zu erkalten. Trat dies ein, scheute sie sich überhaupt nicht davor, das nächste Haus zu betreten und an der erstbesten Türe zu läuten. Sowie ihr geöffnet wurde, neigte sie ihren Kopf leicht zur Seite, zeigte dabei auf Danusch und fragte, ob sie den erkalteten Brei kurz erwärmen dürfe. Sie brachte ihr Anliegen in einem kaum verständlichen Kauderwelsch von Jiddisch-Deutsch-Polnisch vor. Die in solcher Weise Angesprochenen verstanden kaum ein Wort, weshalb sie nur mühsam ein Lachen zu unterdrücken vermochten. Die meisten Angesprochenen kamen dem Wunsche von Frau Cincinati nach und ließen sie den Brei kurz aufwärmen, wussten doch fast alle von der Existenz des jüdischen Obdachlosenheimes. Hinterher amüsierten sich die Angesprochenen über die Jüdin, deren Sprache und Ansuchen sicher köstlich. Fütterungsprozeduren wie die geschilderte endeten nicht selten erst gegen Nachmittag. Um den erkalteten Brei warmzuhalten, scheute sie sich nicht, bei bis zu drei Wohnungsinhabern anzuläuten. Die Cincinatis konnten bald nach Kanada, wo Verwandte von ihnen lebten, auswandern.
Viele, wenn nicht die meisten Heimbewohner, hatten wegen der von den Nazis begangenen Gräueltaten Schrecklichstes durchmachen müssen. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes Gezeichnete. Bei manchen trat dies sichtbar zutage. Einer, zum Krüppel geschlagen und gequält, konnte sich nur mit größter Mühe fortbewegen. Ein anderer, wie alle anderen bedauernswert, schien äußerlich keinen sichtbaren Schaden erlitten zu haben. Sein geistiger Zustand hingegen war gebrochen worden, und zwar dermaßen, dass sich nie mehr ein normaler Zustand einstellen mochte. Die Menschen, mit solchen Eigenschaften behaftet, auf allerengstem Raum zusammenlebend, kamen aus Österreich, Polen, Ungarn, Rumänien und der Tschechoslowakei und waren, betrachtete man es geschichtlich, eigentlich alle „Altösterreicher“.
Bei folgendem Vorfall war Hans zugegen und unfreiwillig Zeuge geworden: Eine jüngere, bildhübsche, nur der vergangenen, unvorstellbar schrecklichen Ereignisse wegen alleinstehende Heimbewohnerin mit wunderschönem vollem schwarzem Haar, jedoch ausgemergeltem Körper, hatte, als einzige ihrer Familie, Jahre in einem der vielen Vernichtungslager überlebt. In unregelmäßigen Abständen erregte sie, eindeutig durch lagerbedingte Erlebnisse hervorgerufen, mehr oder weniger großes Aufsehen. Dies zeigte sich insofern, als sie plötzlich, auf dem Gang hin und her laufend, laut vor sich hin redete und fast zu schreien begann, wobei die Worte „SS“ [21], „Nazi“ und „Gestapo“ [22] am deutlichsten vernehmbar waren. Mit der Zeit schenkte man ihren Anfällen kaum noch Beachtung und nahm sie als gegeben hin, wusste doch jeder, weshalb sie so war. Die Anfälle der armen Frau waren, wie so viel anderes im Heim, zur Normalität geworden. Begegnete man ihr während eines ihrer Anfälle, sah man zur Seite. Einmal sorgte ein neuerlicher, extrem laut ausfallender Anfall dafür, dass die Heimleitung die Ärmste aus dem Heim in eine geschlossene Anstalt einweisen lassen musste. Bevor sie die herbeigerufenen Rettungsleute, weil sie sich vehement dagegen wehrte, festzuhalten und ihr eine Zwangsjacke anzulegen vermochten, war sie den Gang laut schreiend, dabei ein Glas klaren Wassers vor sich haltend, auf und ab gelaufen. Ihre Schreie waren diesmal überaus furchterregend gewesen. Alle, denen sie auf dem Flur begegnete, forderte sie auf, zu ihr herzusehen, weil, und das schrie sie extrem laut, die SS sie nötige, ihr eigenes Blut zu trinken. Gegen das leider nur unter – mäßiger – Gewaltanwendung vollzogene Fortbringen wehrte sich die so sehr Bemitleidenswerte vehement, jedoch vergebens. Wer vermag zu ergründen, welche Gedanken dieser armen, so jungen Frau gerade bei solcher Art des Wegbringens durch ihren verwirrten Kopf jagten?
Stieg man vom ersten zum zweiten Stock hoch, war der ganze linke Teil von der Heimleitung belegt. Die Heimleiterin, Frau Citron mit Namen, war eine Frau in ihren Fünfzigern. Mit ihr bewohnten die riesige Wohnung zwei weitere, wesentlich ältere Damen. Jene wünschten, mit ihren Vornamen, Frau Ella und Frau Olga, angesprochen zu werden. Alle drei waren von kleiner, rundlicher Statur. Die beiden Älteren trugen Brillen mit sehr dicken Gläsern, wobei Frau Olga, die Älteste, fast blind war und am Stock ging. Musste oder durfte man deren Wohnung betreten, was selten der Fall war, wurde man ausschließlich im langen, dunklen Vorraum empfangen. Eine herabhängende, schwache Lampe, mit Lampenschirm versehen, vermochte die Düsterheit kaum zu erhellen. Selbst gutes Sehvermögen ließ nur schemenhaft die im Vorraum befindlichen massiven Möbel ausmachen. Jedoch waren jene Möbel ganz anders gefertigt als diejenigen, die den Heimbewohnern zur Verfügung standen. Wer sich hier befand, durfte sein Anliegen vorbringen oder wurde, gesetzt den Fall, von Frau Citron belehrt oder ermahnt. Ein einziges Mal war Hans dabei, als seine Mutter mit Frau Citron etwas zu besprechen hatte. Er hatte beim Eintreten artig gegrüßt – darauf, dass er dies niemals unterließ, achtete Dorothea –, und während der kurz gehaltenen Unterredung beider Frauen stand er stumm neben seiner Mutter. Derweil stieg ihm der intensive, abgestandene, schwere Duft von bereits schrumpfendem Obst, welches von den Damen auf die umherstehenden Kästen gelegt worden war, in die Nase. Kurz gesagt roch es sehr modrig. Im Allgemeinen wurden Besprechungen in den Zimmern der Heimbewohner oder im anfänglich vorhandenen, jedoch kaum von jemandem benutzten Gemeinschaftsraum abgehalten. Es war sicherlich nicht einfach, so vielen Menschen wie auch Mentalitäten, zudem lauter Juden, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Sie gar unter einen Hut zu bringen, war und blieb ein unmögliches Unterfangen. Die anfangs von Frau Citron gehandhabte, sicherlich unbeabsichtigte unsensible Zusammenlegung von einander fremden Personen führte zwischen manchen von ihnen, je nach gegebener Sachlage, hin und wieder zu verbalen Auseinandersetzungen. Obschon selten, wurden diese auch mal handgreiflich ausgetragen. Sonderbar, dass in solchen Momenten keinem der an derlei Auseinandersetzungen Beteiligten in den Sinn kam, was sie nicht alles in den vergangenen Jahren, von Demütigungen angefangen bis hin zum Schrecklichsten, ohne im Geringsten murren und mucksen zu dürfen, hatten erdulden und erleiden müssen.
Dorothea wurde nur dann bei Frau Citron vorstellig, wenn sie in Erfahrung bringen konnte, dass jemand, der ein größeres Zimmer bewohnte, aus dem Heim wieder wegziehen konnte. Seit nun geraumer Zeit konnte sie das stichhaltigste zum Ziel führende Argument vorbringen. Sie betonte gegenüber der Heimleiterin, dass sie die Familie seien, welche die längste Zeit im Heim wohnte. Dem konnte Frau Citron nichts entgegenhalten, und Dorothea bekam das ins Auge gefasste Zimmer zugesprochen.
Das Sichwaschen musste nach wie vor mit kaltem Wasser vollzogen werden. Hatte man das ganz normale Bedürfnis, sich waschen zu wollen, gab es drei Möglichkeiten. Man konnte dies direkt im Stiegenhaus an der Bassena erledigen, was die meisten männlichen Bewohner taten. Wer eine andere Möglichkeit vorzog, wusch sich in der Gemeinschaftsküche am Blechbecken. Dies auch dann, wenn zur gleichen Zeit jemand mit Kochen beschäftigt war. Die dritte Variante war, sich in seinem Zimmer zu waschen. Dies konnte wiederum nur dann vollzogen werden, wenn man ein Behältnis wie ein Lavoir oder einen größeren Topf besaß. Wofür man sich auch entschied, im seltensten Fall konnte man ungestört und alleine seine Waschprozedur erledigen. Obschon jedem bewusst war, dass es einfach nicht anders zu bewältigen war, kamen zwischendurch immer wieder Unstimmigkeiten auf. Solche führten wiederum dazu, Frau Citron herbeirufen zu müssen, um diese zu schlichten. Alsbald erstellte sie einen auf Papier festgehaltenen Plan, welcher geregelte Körperpflege- wie auch Kochzeiten festlegte. Diesen befestigte sie persönlich mit Reißnägeln an der Küchentüre. Von ihrer Sicht aus sollte nach genauem Einhalten dieser Vorgaben fortan einigermaßen Ruhe und Ordnung herrschen. Da hatte sie sich aber getäuscht gehabt. Kaum jemand wollte sich, endlich wieder in Freiheit und Frieden lebend, abermals vorschreiben lassen, was man wann zu tun und wann zu unterlassen habe. Somit hielt der ausgeklügelte Plan kaum länger als zwei, drei Wochen stand. Was das Kochen anbelangte, gab es anfänglich in den Küchen keinerlei Probleme, besaß doch kaum jemand Geschirr, geschweige Nahrungsmittel, um kochen zu können. Daher wurden die Küchen vorerst hauptsächlich als Waschräume benutzt.
Um die mittellosen Heimbewohner zu verköstigen, hatte die Israelitische Kultusgemeinde in der Leopoldsgasse im zweiten Bezirk eine „Ausspeisung“ genannte Lokalität eingerichtet. Das war eine Art Restaurant, in welchem auch arme Juden, die nicht im Heim wohnten, drei Mahlzeiten pro Tag gratis oder gegen einen geringen Beitrag verabreicht bekamen. Um Gratismahlzeiten zu erhalten, kam es darauf an, in welche Bedürftigkeitskategorie man eingestuft war. Fast täglich gab es Gersten- oder Hafersuppe, danach eingemachtes oder ausgelaugtes Fleisch mit Beilage und zum Abschluss einen kleinen Nachtisch. Viele, die dort hingingen, waren wahrlich, um nicht hungern zu müssen, über diese Einrichtung sehr froh. Von Mal zu Mal jedoch nutzten immer weniger Heimbewohner das Angebot. Ihnen war der Weg von der Tempelgasse dorthin zu weit oder zu mühsam. Eine Zeitlang, und dann nur zum Mittagessen, waren Hans und Erika zugegen. Kindern, welche die Ausspeisung aufsuchten, wurde obendrein vorweg Lebertran in Kapselform verabreicht.
Ein kostbares, jedoch verbotenes Gut besaßen Heimbewohner, die einen Tauchsieder oder gar einen kleinen, mit offen liegenden Drahtspiralen versehenen elektrischen Kocher ihr Eigentum nennen oder sich verbotenerweise derlei besorgen konnten. Beides zu benützen war strengstens untersagt, weshalb es von jenen, die solches besaßen, tunlich verschwiegen wurde. Mit solchem Gerät war es möglich, sich ein warmes Getränk oder eine kleine Speise in seinem Zimmer zuzubereiten und dem mit der Zeit in der Küche vermehrt vorkommenden Gedränge und Gezänk auszuweichen. Die erwähnten Geräte waren während oder nach Inbetriebnahme, neben den immer wieder vorkommenden Pannen der Wiener Elektrizitätswerke, häufig der Auslöser dafür, dass ein ganzes Stockwerk nicht nur in Dunkelheit, sondern in totale Stromlosigkeit gestürzt wurde. Trat ein durch solches Gerät ausgelöster Stromausfall ein, ertönte augenblicklich aus allen davon betroffenen Zimmern ein von Mal zu Mal lauter werdendes Fluchen, aus Solidarität auch aus dem Zimmer des Verursachers. Nach und nach traten Betroffene auf den Gang hinaus, um die verschiedensten Vermutungen über die Ursache des Stromausfalles und Theorien zu dessen Behebung anzustellen. Da es logischerweise auch am Gang dunkel war, gesellte sich alsbald jemand, eine Kerze in der Hand haltend, dazu, der sich obendrein als handwerklich begabt ausgab. Seine für manchen Umherstehenden unverständlichen Ausdrücke und dem längerem Daherreden nach hielt man ihn für kompetent und folgte seinen Anweisungen. Kerzen zu besitzen waren alle Heimbewohner genötigt. Nach einigem Beraten und Umhersuchen ortete endlich einer einen über Kopfhöhe befindlichen Sicherungskasten. Der „Fachmann“ stieg auf einen inzwischen herbeigeschafften Sessel. Während er in der einen Hand die Kerze als Lichtquelle hielt, tastete er mit der anderen im Sicherungskasten herum. Er prüfte eine Sicherung nach der anderen, weil er eine als durchgebrannt vermutete. Bei Kerzenschein war das Unterfangen recht mühsam. Sowie er endlich die defekte Sicherung ausgemacht und herausgeschraubt hatte, meinte er, da keinerlei Ersatzsicherungen vorhanden waren, diese dennoch unter gewissen Umständen flicken zu können. Dann war ein erstauntes „Ah“ von einigen Umherstehenden vernehmbar. Er meinte, während er in die Runde blickte, dazu ein Stück dünnen Draht oder etwas Stanniolpapier zu benötigen. Sofort machten sich welche auf den Weg in ihre Zimmer, um nach Schokolade, die von solchem Papier umwickelt war, zu suchen. Die Alternative, Draht, besaß ohnehin niemand. Hatte jemand Stanniolpapier herbeigeschafft, hantierte der verkappte Elektriker mit diesem eine Weile an der Sicherung herum. Anschließend schraubte er diese sehr vorsichtig in die Fassung. Unmittelbar danach machte ein mehrstimmiges, Beifall spendendes, leises Gemurmel und abermaliges „Ah“ die Runde. Das Licht ging im Flur wieder an und fiel durch die offen stehenden Zimmertüren in diesen Flur ein.
Unter den Heimbewohnern waren wenige, die man der orthodoxen Glaubensgemeinschaft zuzählen konnte. Mit diesen gab es dann Probleme, wenn ihnen, der strikten Befolgung der Gebote am Sabbat [23] wegen, jegliche Tätigkeit zu tun verboten war. Musste man nach einem solchermaßen tief Gläubigen die Toilette aufsuchen, konnte man gewiss sein, diese benutzt und nicht hinuntergespült vorzufinden. Für jene war das Hinunterziehen der Spülkette eine Tätigkeit, die am Sabbat zu den Verboten zählte, somit nicht ausgeführt werden durfte. Es war vonnöten, das Klosett stets mit zurechtgeschnittenem Zeitungspapier aufzusuchen. Hätte man darauf vergessen, wäre man in eine peinliche Lage geraten. Von der Heimleitung wurde kein Papier zu Verfügung gestellt. An den vor sehr langen Zeiten weißgrau getünchten Klosettwänden war Hans aufgefallen, dass an vielen Stellen die Farbe in Zentimeterbreite und einigen Zentimetern Länge abgeblättert oder kurz davor war. Die Ursache dessen war, dass manche Benutzer kein oder aber zu wenig zurechtgerissenes Zeitungspapier mitgenommen hatten. An den Wänden war somit sichtbar, auf welche Weise diejenigen sich gesäubert hatten. Sobald es zu dunkeln begann, durfte man weder Kerze noch Streichhölzer zum Toilettengang mitzunehmen vergessen. Wohl waren Lampenfassungen in allen WC-Anlagen am Plafond angebracht, jedoch nicht mit Glühbirnen versehen.
Für die oberflächliche Reinhaltung der Stiegen, Gänge, Gemeinschaftsküchen und Klosetts war ein älteres, nicht jüdisches Ehepaar zuständig. Man sprach sie mit deren Vornamen Johann und Johanna an. Bald wurden sie von einem anderen Ehepaar, Sehr mit Namen, ersetzt. Das Ehepaar war aus Israel, wohin es geflüchtet war, mit ihrer dort geborenen Tochter Hanni nach Wien zurückgekommen.
Die Sehrs mit ihrer kleinen, rothaarigen Tochter Hanni zogen im Heim ein und bewarben sich sofort um die Anstellung als Hausbesorger. Sie bekamen die Stelle zugesprochen und durften die im Parterre gelegene und bis dahin leer stehende Hausbesorgerwohnung beziehen. Die bislang unbewohnte Wohnung war unter den Heimbewohnern schon länger ein beliebter Gesprächsstoff. Manche intakte Familie wäre noch so gerne in diese eingezogen. Die damit verbundenen Hauswarttätigkeiten, die der Posten beinhaltete, die wollte niemand auf sich nehmen. Die Sehrs hingegen waren glücklich, sowohl diese große Unterkunft wie auch die Anstellung bekommen zu haben.
Immer noch mussten Dorothea und ihre Kinder um in ihr Zimmer zu gelangen oder dieses zu verlassen, jenes von den Frauen Adler und Rosenberger und deren Tochter Hanni durchschreiten. Frau Rosenberger war durch Hitlers Machenschaften sehr jung zur Witwe und ihre drei Kindern somit vaterlos geworden. Sie war eine sehr fromme Jüdin, trug sogar einen „Scheitel“ (Perücke) [24]. Hanni war ein äußerst rassig aussehendes und sehr hübsches Mädchen, welches ihr pechschwarzes Haar zu dicken Zöpfen geflochten trug. Frau Rosenberger hatte neben Hanni noch zwei Söhne. Jene hatten in einem orthodoxen Männerheim Wiens Unterkunft gefunden. Die Rosenbergers konnten das Heim nach wenigen Monaten Aufenthalt in Richtung Israel verlassen und kurz danach auch Frau Adler.
Solange Dorotheas Kinder nicht im schulpflichtigen Alter waren und sie diese hin und wieder alleine im Zimmer zurücklassen musste, schloss sie diese, sobald sie außer Haus zu tun hatte, für den Zeitraum ihres Wegbleibens darin ein. Die Zeit ihrer Abwesenheit war besonders für Hans von Langeweile geprägt. Spielsachen waren weder für Erika noch für ihn vorhanden. In solchen Fällen begnügte Hans sich damit, sich bei geöffnetem Fenster aufs Fenstersims zu lehnen und dem Treiben in der Tempelgasse zuzusehen. Nicht selten fielen ihm Männer auf, welche die Gasse nach ausgerauchten, weggeworfenen Zigarettenstummeln gewissenhaft absuchten. Sobald ein Stummel entdeckt wurde, wurde dieser aufgehoben und sofort nach weiteren gesucht. Hatten sie eine bestimmte Menge gesammelt, lösten sie die noch vorhandenen Tabakreste heraus. Hernach füllten sie diese, sofern sie Zigarettenpapier besaßen, in dieses, wenn nicht, so auch in zurechtgeschnittenes Zeitungspapier, welches sie geschickt zur Zigarettenform rollten. Dann wurde die Selbstgerollte angezündet und genussvoll zu rauchen begonnen. Nicht nur Männer, auch Frauen konnte Hans beobachten. Jene waren weniger hinter Zigarettenresten her. Sie waren mit Schaufel und Besen unterwegs, um die Straßen nach Pferdhinterlassenschaften abzusuchen. Solche waren täglich zu finden und meist von vielen Spatzen belagert. Frauen suchten danach, um diese ihren Blumentöpfen oder Schrebergärten als Dünger zuzuführen. Es gab auch Tage, an denen von der Gasse oder vom Hof her Musikklänge ertönten. Die kamen von Instrumenten, welche von Straßenmusikanten betätigt wurden. Dabei konnte es sich um eine Drehorgel, ein Akkordeon oder eine Gitarre, aber auch um eine Mundharmonika handeln. War eine Drehorgel dabei, befand sich diese auf einem zweirädrigen Gestell. Mit diesem ging das Manövrieren leichter vonstatten.
Nach Darbietung von drei, vier Melodien erhofften sich die Musikanten, dass all jene, die zu ihnen aus ihren Fenstern hinabsahen und den Melodien lauschten, wenigstens ein paar Münzen hinabwerfen mögen. Einige taten es auch, worauf die Musikanten Dankesworte murmelnd, jovial kurz ihre Kappen abzogen und wieder aufsetzten, die umherliegenden Münzen aufklaubten und zum nächsten Haus weiterzogen.
Unter einigen Fischern, die im nahe gelegenen Donaukanal oder im in diesen einfließenden Wienfluss fischten, hatte es sich herumgesprochen gehabt, dass man im Heim, da wo Juden untergebracht waren, Fische rascher als anderswo veräußern konnte. Tauchte einer im Heim auf, trug er einen rucksackähnlichen, mit Wasser gefüllten Metallbehälter am Rücken, klopfte an jeder Tür an und bot jedem, der ihm öffnete, seinen Fang an. Selten ging er nicht schon nach kurzer Zeit leer gekauft wieder davon. Ebenso, auch dies konnte Hans vom Fenster aus beobachten, pries etwa zweimal im Jahr lauthals ein Scherenschleifer seinen Dienst an. Solch ein seine Dienste Anbietender kam immer mit einem Kumpanen daher. Während einer das Gestell mit dem schweren Schleifstein, welches je nach Beschaffenheit auf einem oder zwei Rädern montiert war, vor sich herschob und dieses vor dem Haus, das sie zu beglücken im Sinne hatten, platzierte, war sein Kollege im dazugehörigen Hauseingang verschwunden, um sich lauthals anzukündigen. Hausbewohner, die etwas zum Schleifen hatten, brachten dies nach unten. Sie übergaben ihre Geräte dem „Fachmann“, der sich sogleich an die Arbeit machte und für die Tätigkeit ein paar Groschen verlangte. Sobald die Scherenschleifer weiterzogen und für Hans nicht mehr sichtbar waren, ihm alsbald auch am Fenster langweilig zu werden begann, wendete er sich wieder dem Zimmer zu. Er überlegte kurz, was er wohl tun könne. Nach kurzem Überlegen machte er sich daran, die Nachttischlampe seiner Mutter zu untersuchen. Deshalb schraubte er die Birne heraus, um mit einer Häkelnadel, die zu seinem Glück einen Holzgriff hatte, in der Lampenfassung herumzustochern. Je nachdem, worauf er mit der Nadel drückte oder welchen Innenteil diese berührte, knallte und rauchte es zwischendurch. Obschon er dann erschrak, faszinierte ihn dies. Bei solchem Unterfangen hatte Hans einen großen – wenn nicht mehrere – Schutzengel zur Seite. Man darf den Gedanken nicht weiter verfolgen, was geschehen wäre, wenn …
Auf derselben Ganghälfte wie die Gamliels wohnten zwei weitere Familien. Die eine hieß Müller und die andere Rerucha. Das Ehepaar Müller hatte zwei erwachsene Söhne. Herbert, der Ältere, war wie sein Vater Musiker von Beruf, Erwin, der Jüngere, ein ausgezeichneter Artist. Hans war durch Zufall dazugekommen, Erwin einmal bei dessen täglichem Training zu beobachten. Erwin befand sich im kaum benutzten Gemeinschaftsraum alleine. Die Türe zu diesem stand jedoch einen Spaltbreit offen. Auf dem Boden vor ihm stand eine – sicherlich präparierte – leere Flasche. In diese steckte er seinen Zeigefinger hinein. Danach und nur auf diesen gestützt, begann er im Zeitlupentempo einen einhändigen Handstand zu vollführen. Hans war baff und staunte nur. Er war von der einzigartigen Darbietung solch eines Kraftaktes fasziniert. Jahrzehnte später bei einem Gespräch, welches Hans in der Schweiz mit Zirkusfachleuten führte und ihnen davon erzählte, sagten ihm diese, dass es in Europa nur einen gab, der diese artistische Leistung zu vollbringen imstande war. Derjenige hatte sich einen Künstlernamen zugelegt, an den sie sich nicht mehr erinnern konnten.
Herbert Müller war mit Elfi, der Tochter von Familie Rerucha, jung verheiratet. Elfi war hochschwanger. Sie wurde bald von einem Mädchen entbunden, das sie Hanni nannte. Beide Familien, Müller und Rerucha, fanden rasch bessere Wohnmöglichkeiten, weshalb alle das Heim nach sehr kurzem Aufenthalt verlassen konnten. Jahre später, Hans war von seiner Arbeitsstelle in der Schweiz auf Urlaub in Wien, machte er an einem Abend mit einer Gruppe Spanier eine Stadtrundfahrt. Diese wurde vom Verkehrsverein unter dem Namen „Wien bei Nacht“ angeboten und von seiner Mutter als Fremdenführerin geleitet. Unter den Sehenswürdigkeiten war auch ein Kurzaufenthalt im Wiener Moulin Rouge [25] eingeplant. In diesem Etablissement begegneten Hans und seine Mutter Herbert Müller, der in der Bar als Pianist engagiert war.
Herr und Frau Mundstein mit ihren Söhnen Walter und dem jüngeren Heinz hatten ebenfalls nur einen kurzzeitigen Heimaufenthalt durchzustehen gehabt. Heinz leitete in späteren Jahren als Erwachsener eine bekannte Wiener Tanzschule in der Mariahilfer Straße. In dieser setzte er sich besonders für die Integration von blinden Mitbürgern ein. Wie die Mundsteins und andere bereits erwähnte Heimbewohner konnte auch Frau Seidel mit ihrem Sohn Heinz, der den Schneiderberuf erlernte, dem Heim ziemlich bald den Rücken kehren und gleichfalls ausziehen. Zurück blieben Dorothea mit Hans und Erika, und dies, obschon Dorothea auch nicht die winzigste Möglichkeit ausließ, dem tristen Heimleben zu entkommen. Jedes ihrer Unterfangen war und blieb noch lange vergebens.
In den Zimmern im letzten, dem dritten Stockwerk waren fast ausschließlich Männer untergebracht. Alle waren einsame, verbitterte und in sich gekehrte Männer, denen kaum einmal ein Wort über die Lippen kam. Wenige weitere Stufen führten zum Dachboden hoch. Hans hatte längst ausgekundschaftet, dass die schwere Eisentüre, durch welche man auf den Dachboden gelangte, nicht verschlossen war. So erkor er auch diesen Bereich des Hauses zu einem seiner als Geheimnis gehüteten Spiel- und Aufenthaltsbereiche. An der Eisentüre war wohl ein Zettel angebracht, der den Aufenthalt auf dem Dachboden außer zum Wäscheaufhängen und -trocknen untersagte. Am Beginn seines Heimaufenthaltes, des Lesens noch unkundig, übersah Hans diesen Zettel, später ignorierte er ihn.
Arg verstaubte, dicke Holzbalken durchliefen kreuz und quer diesen riesigen, den ganzen Unterbau überdeckenden Raum. Über Kopfhöhe waren parallel laufend feste Schnüre gespannt, die zum Aufhängen und Trocknen von Wäsche bestimmt waren. Auch die Schnüre waren mit Staub belegt. Dies war nicht verwunderlich, weil sie nie benutzt wurden. Es besaß niemand mehr Wäsche als jene, die getragen wurde. Wo hätte man noch dazu mit kaltem Wasser Wäsche waschen sollen? Wie sauber wäre diese geworden? Hans hatte ungemein Spaß, über die vielen Balken zu springen oder auf ihnen zu balancieren. Schien die Sonne aufs Dach, heizte sich die Luft auf dem Dachboden dermaßen stark auf, dass sie kaum zum Einatmen war. Das störte den Knaben keineswegs. Zwischendurch genoss er den herrlichen weiten Ausblick aus den vielen Dachluken. Von diesen konnte er in den Hof hinunter und die ganze Tempelgasse entlang bis hin zum und über den Donaukanal hinweg sehen. Der Stiegenhausabschluss zum Dach hin bestand aus einem gitterähnlichen Eisengestell. In dieses waren mit Metalldrähten durchzogene Glasscheiben eingelassen. So konnte das Tageslicht durchscheinen, wodurch das Stiegenhaus tagsüber genügend hell erleuchtet war.
Ebenso gerne hielt sich Hans zwischendurch bei Herrn Breier, dem Tischler, in dessen Werkstatt auf. Dieser hatte nichts dagegen, wenn ihm der Knabe bei seinen Arbeiten an der Hobelbank oder an der Fräse zusah. Fast täglich ließ Herr Breier die Fräse laufen. Für spezielle Arbeiten war deren Gebrauch unumgänglich. Deren kreischender Lärm war hingegen im ganzen Heim bis ins allerletzte Zimmer unangenehmst vernehmbar. Hin und wieder durfte Hans beim Hantieren mit Brettern behilflich sein. Seine Lieblingsbeschäftigung war jedoch, mit dem im hinteren Hofteil abgestellten, großrädrigen Holzkarren des Tischlers über den holprigen Innenhof hin und her zu fahren.
4. Die Nachbarn
Vis-à-vis vom Heim wohnte Frau Treidl mit ihrem Sohn Walter. Jener war zwei Jahre älter als Hans. Frau Treidl war die allererste Frau, die sich damit zu beschäftigen begann, die im Tempelhof umherliegenden, von der Tempelruine stammenden Ziegelsteine unter den Schuttmassen hervorzuklauben. Jeden einzelnen klopfte sie sodann mit einem kleinen Beil vom noch anhaftenden Mörtel ab. Die gesäuberten Ziegelsteine schlichtete sie zuerst neben- und danach aufeinander. Mit der Zeit entstand ein ansehnlicher Quaderblock. Kurze Zeit, nachdem Frau Treidl mit dieser Tätigkeit begonnen hatte, gesellten sich weitere Frauen, die Frau Treidl mitzumachen animiert hatte, zu ihr. Es war eine harte Arbeit, die die Frauen verrichteten. Einige holten mittels Pickel, andere mit bloßen Händen Ziegelsteine unter dem Schutt hervor. Andere säuberten diese und weitere schlichteten die Steine auf- und nebeneinander. Damit verdienten sich alle ein paar Groschen. Monate später gesellte sich Herr Treidl dazu. Erst jetzt war er, aus russischer Gefangenschaft entlassen, heimgekehrt. Sogleich versuchte er, bei dieser Arbeit mitzuverdienen. Es gab kaum andere Verdienstmöglichkeiten. Die ganze Wirtschaft lag danieder. Dieser Leute Arbeit trug jedoch wesentlich zum ziemlich raschen Wiederaufbau der arg zerstörten Wienerstadt bei.
Im Heim gab es das übliche Ein- und Ausziehen. Einige Wegziehende zog es ins „Gelobte Land“, andere in die USA, nach Kanada oder gar nach Australien. Die meisten Abreisenden suchten die Nähe von Verwandten, so überhaupt noch welche am Leben waren. Für Dorothea stand es von Anfang an fest, keinesfalls, egal was noch alles geschehen mochte, auszuwandern, sondern in Wien zu bleiben.
Ein eben frei gewordenes Zimmer wurde von einer neu angekommenen Familie bezogen. Es waren ein Vater, dessen hochschwangere Gattin sowie deren beide Söhne Hans und Robert. Diese Familie hatte ihren Heimaufenthalt von vornherein nur für kurze Dauer geplant gehabt. Sie wollten nach Israel auswandern. Da sie noch nicht alle nötigen Papiere beisammen hatten, gedachten sie, die Wartezeit im Heim zuzubringen. Ihr Familienname war Schärf. Hans war der ältere Sohn, Robert, der jüngere, wurde Robby gerufen. Während ihrer kurzen Aufenthaltszeit im Heim war Robby Spielgefährte vom „Heim-Hans“. Kaum, dass sich die Familie in wenigen Wochen im Heim eingelebt hatte, geschah das Unvorstellbare. Vater Schärf ging einer Arbeit nach. Um dahin zu gelangen, musste er die Straßenbahn benutzen. Eines Tages lief er einer bereits anfahrenden Straßenbahn hinterher. Die Waggons hatten keine Türen, sondern stets offene Zutritte. Herr Schärf versuchte, die außen angebrachten Griffstangen zu fassen und auf das Trittbrett aufzuspringen. Er rutschte jedoch ab, fiel dabei unter die Straßenbahngarnitur, von welcher er überrollt und sofort getötet wurde. Wie ein Lauffeuer breitete sich diese schreckliche Nachricht bis zum Heim hin aus. Das Unglück geschah direkt auf der noch immer durch Kriegsereignisse arg beschädigten, keine fünf Minuten zu Fuß vom Heim befindlichen Aspernbrücke. Nach einer Weile sprach jemand davon, dass es sich bei der verunglückten Person um jemand aus dem Heim handeln solle. Groß waren deshalb der entstandene Aufruhr und die Ungewissheit. Sowie der „Heim-Hans“ von der Sache gehört hatte, eilte er umgehend zur nahe gelegenen Brücke. Auf ihr hatte sich inzwischen ein Stau von mehreren Straßenbahnen gebildet. Gruppen gestikulierender und diskutierender Passanten standen auf beiden Seiten der Brücke und sahen zur Brückenmitte hin. Dort konnte man ein dickes, braunes, ausgebreitetes Packpapier sehen, unter welchem die verstümmelte Leiche von Herrn Schärf abgedeckt lag. Kurz danach war es offiziell. Frau Schärf, die sich im Heim aufhielt, wurde von Polizeibeamten vom schrecklichen Ereignis amtlich informiert. Trotz dieses schweren Schicksalsschlages schenkte sie kurz darauf Gerry, einem dritten, gesunden Sohn das Leben. Wenige Wochen nach dessen Geburt hatte sie die fehlenden Papiere für ihre Ausreise beisammen. Die nun vaterlos gewordene Familie reiste nach Israel ab, einer besseren Zukunft, wie sie erhofften, entgegen.
In der Nähe des Fleischmarktes im ersten Bezirk fand Dorothea bei der Zensurstelle im Postgebäude [26] eine zeitweilige Anstellung. Dank ihrer vielen perfekten Sprachkenntnisse und ihrer Fähigkeit, noch so Hingeschmiertes rasch lesen zu können, war ihr diese Temporärstelle zuerkannt worden. Mit dieser Arbeit verdiente sie erstmals etwas Geld. Dieses wurde ausschließlich zum Kauf von Lebensmitteln eingesetzt und reduzierte aber auch das andauernde und erniedrigende Betteln- und Bittenmüssen bei diversen Ämtern oder Zuteilungsstellen.
Da außer der Hausbesorgerwohnung und jener der Heimleitung kein weiteres Zimmer mit einem Heizkörper ausgestattet war, war es während der Winterzeit im ganzen Haus äußerst kalt. Jeder noch so kleine Luftzug drang ungehindert zwischen den Fensterrahmen und Scheiben hindurch. Alle Fenster waren undicht, weil sie nur noch von uraltem, teils gerissenem, teils herausgebröckeltem Kitt im Rahmen festgehalten wurden. Auch bei den Türen zog es von allen Seiten herein. Das war der Grund, weshalb Dorothea, sobald sie genügend Geld beisammen hatte, einen auf drei Beinen stehenden, kleinen, im Geschäft als Petroleumofen angepriesenen Heizkörper kaufte. Sie brachte diesen heim und stellte ihn in der Zimmermitte auf. Ein im unteren Teil befindlicher Behälter, aus dem ein Docht herausragte, musste, wollte man dieses Gerät in Betrieb nehmen, zuvor mit Petroleum aufgefüllt und dann musste der Docht angezündet werden. Das als Ofen benannte und darob gekaufte Gerät heizte jedoch überhaupt nicht. Hingegen verbreitete es im Zimmer einen immensen Gestank nach Petroleum. Der einzige Pluspunkt am Gerät war eine Abdeckplatte. Auf diese ließ sich ein mittelgroßer Topf oder eine Pfanne stellen und erwärmen. Mit der Zeit gewöhnten sich alle an den Petroleumgestank und nahmen ihn kaum noch wahr. Damit war Dorothea nicht mehr auf die Gemeinschaftsküche angewiesen, so sie nur eine Kleinigkeit zuzubereiten im Sinne hatte. Einmal hatte sie auf dieses Öfchen eine Pfanne mit Öl gestellt. Sie beabsichtigte, dieses zu erhitzen und darin etwas zu braten. Nur für kurze Zeit musste sie sich in die Gemeinschaftsküche begeben, um dort nach etwas zuvor schon zum Kochen Aufgestelltem zu sehen. Derweil hatte das Öl in der Pfanne zu brutzeln begonnen. Klein-Erika alleine im Zimmer bemerkte dies und wollte ihrer Mutter behilflich sein. Sie fasste den Pfannenstiel und hantierte dabei, weil das heiß gewordene Öl hochzuspritzen anfing und sie von einem Spritzer getroffen worden war, ruckartig. Dabei goss sie sich heißes Öl über ihre Hand und ließ die Pfanne auf den Boden fallen. Der Schmerz ließ sie laut aufschreien und weinen. Ihr lautes Geschrei, welches bis in die Küche hörbar war, alarmierte Dorothea. Umgehend eilte sie ins Zimmer zurück. Sie sah die Pfanne am Boden, das ausgeleerte Öl, die schreiende Tochter, der von der Hand Hautfetzen weghingen. Sie packte Erika, mit der sie ins Nachbarhaus, den Nestroyhof [27], zum Arzt eilte. In der Ordination wurde sie ambulant sofort als Notfall behandelt und mit beruhigenden Worten vom Arzt danach wieder entlassen.
Das wenige Geld, das Dorothea sporadisch verdiente, reichte gerade dazu, um nicht Hunger leiden zu müssen. So war es unumgänglich und nicht nur bei ihnen Usus, bei größeren Einkäufen den Teilbetrag, der einem für die komplette Bezahlung fehlte, „bis zum nächsten Mal“ anschreiben zu lassen. Es gab vielerlei Gründe, dass Schulden zum vereinbarten Termin nicht beglichen werden konnten, was die Beitreibung zur Folge hatte. Bald danach erschien beim Schuldner ein Beamter mit obligater, stark abgegriffener, alter Aktentasche. Er sah sich in dem vor Dürftigkeit strotzenden Zimmer noch und noch, fast immer vergeblich, nach pfändbaren Gegenständen um. Entdeckte er zuletzt doch noch etwas, wie zum Beispiel bei den Gamliels den winzig kleinen schwarzen Volksempfänger, war ihm die Erleichterung anzusehen. Sofort klebte er auf die Rückseite des Gerätes eine Marke. Auf der amtlichen Pfändungsmarke war der obligate Doppeladler ersichtlich. Die Marke wurde deshalb Kuckuck genannt. Nach kurzer Erläuterung, wie man sich in Bezug zur aufgeklebten Marke zu verhalten habe, ging er wieder weg. Von diesem Moment an stand Dorothea eine vorgegebene Zeitspanne zur Verfügung, in welcher sie die offene Rechnung samt Spesen begleichen sollte. Andernfalls würde das Radio eingezogen werden. Zu Pfändungen kam es bei ihnen nie, hin und wieder aber zu neuerlichen Besuchen des Beamten. Der ganze Ablauf war mit einem sich drehenden, jedoch nicht vom Fleck kommenden Ringelspiel vergleichbar, genauso, wie es der großartige Komponist Hermann Leopoldi [28] in einem seiner vielen Lieder („Schön ist so ein Ringelspiel …“) besungen hatte.
Trotz dieser Widerwärtigkeiten hatten weder Hans noch Erika jemals das Gefühl, dass ihnen etwas abging oder dass sie Hunger leiden mussten. Dies war einzig dem Erziehungsmodus ihrer großartigen Mutter und deren phänomenalem Improvisationstalent zuzuschreiben. Dorotheas vorrangigster Lebensinhalt und erstrebenswertes Ziel war, ihren beiden innig geliebten Kindern mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten, auch wenn diese noch so minimal waren, die bestmögliche Erziehung und Ausbildung zu bieten. Ab und zu musste sie ihnen erklären, dass ihr dies und jenes aus diesem und jenem Grund zu machen oder zu kaufen nicht möglich sei. Ohne nachzufragen verstanden sie beide Kinder.
Waren sich, was selten vorkam, Heimbewohner doch etwas näher gekommen, war es eine Selbstverständlichkeit, sich bei Engpässen von Lebensmitteln gegenseitig auszuhelfen. Handelte es sich um Zucker, Mehl, Milch und Ähnliches, half man tassenweise aus und erwartete, hernach die gleiche Menge zurückzubekommen. Ließ sich jemand mit der Rückerstattung zu lange Zeit, vergaß absichtlich oder unabsichtlich darauf, scheute sich keiner davor, den Schuldner unmissverständlich darauf hinzuweisen. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen gingen sich die meisten Heimbewohner, sich zwar grüßend, aus dem Wege. Wenn sie überhaupt einmal miteinander redeten, waren sie nur kurz angebunden. Manche mochten sich aus diesem oder jenem Grund nicht leiden, besonders dann, wenn einer vom anderen annahm, dass ihm der andere etwas mit Absicht zuleide tat. Peu à peu stachelten sich die Widersacher mit gehässig hingeworfenen Worten gegenseitig auf, und urplötzlich artete dies in eine handgreifliche Auseinandersetzung aus. Sah sich in solchem Falle die Heimleitung außerstande, Einhalt zu gebieten, oder war gerade nicht anwesend, wurde jemand ins nahe gelegene Polizeiwachzimmer in die Ferdinandstraße geschickt, um über den Vorfall zu berichten. Nachdem sich ein protokollierender Beamter dort Notizen gemacht hatte, schickte dieser einen oder zwei Polizisten zum Heim, um nachzusehen. Sehr gemächlich, weil bereits ahnend, was zu erwarten war, weil nicht zum ersten Male geschehen, machte man sich auf den Weg. War man angekommen, wurde amtsgehandelt. Des besonderen Status des Heimes und dessen Bewohner wegen endeten die meisten Polizeiinterventionen mit bloßen Abmahnungen.
5. Onkel Paul
Durch das ausnehmend herzige und einnehmende Gebaren Erikas wurde Dorothea mit einem erst kürzlich ins Heim eingezogenen Mann bekannt. Er war Wiener, Musiker von Beruf, stammte ursprünglich aus der Brigittenau, dem 20. Bezirk Wiens, und hieß Paul Braun. Eben erst war er aus der Sowjetunion, wohin er vor Hitler geflüchtet war und wo er zehn Jahre lang in der Emigration zugebracht hatte, in seine Heimatstadt Wien zurückgekehrt. Im Gegensatz zu seinem um zehn Jahre älteren Bruder Otto, der verheiratet und praktischer Arzt war und noch vor 1938 mit seiner ersten Frau Anni in die USA ausgewandert war, war Paul im allerletzten Moment, weil ihm keine Wahl mehr blieb, in den Osten geflüchtet. Über die Tschechoslowakei und Polen schlug er sich bis in die Ukraine nach Russland durch. Sowie man ihn aufgegriffen hatte, wurde er umgehend nach Sibirien deportiert. Sein Überleben all die Jahre hindurch verdankte er dem Umstand, dass er sowohl sehr gut Klavier wie auch Akkordeon spielen konnte, und oftmaligem großen Glück.
Als Paul Braun aus der Emigration zurückgekehrt war, hatte er sein ehemaliges Wohnhaus und das Textilgeschäft seiner Eltern in der Wallensteinstraße zerbombt vorgefunden. Von seinem Bruder Otto wusste er nur, dass dieser irgendwo in den USA lebte. Wie andere Rückkehrer wandte auch er sich an die im ersten Bezirk residierende Kultusgemeinde. Die verwies ihn ans jüdische Obdachlosenheim in der Tempelgasse. Sein ganzer Besitz fand in einem kleinen, mit Lederriemen zusammengehaltenen Pappköfferchen Platz. Dieser bestand aus wenigen, eher als zerlumpt oder abgetragen zu bezeichnenden Kleidungsstücken, wenigen Notenblätter und einigen Familienfotos aus seiner Jugendzeit. Daneben besaß er eine Klarinette mit dazugehörigem Etui. Von Frau Citron, an die er sich wenden musste, war ihm eine Bettstatt in einem der Männerzimmer im dritten Stock zugewiesen worden. Um nicht in Trübsal zu verfallen und sich die auf ihn nun zukommende, langweilige und vor allem ungewisse Zeit kurzweiliger zu gestalten, begann er, neben dem Artisten Heinz Müller, den Gemeinschaftsraum aufzusuchen. Sie waren die einzigen Benutzer dieses Raumes, wobei sie aber niemals aufeinandertrafen. Hier begann Paul Braun, auf seiner Klarinette zu üben. Das Instrument schien er noch nicht lange besessen zu haben. Im Heim war für ihn kein Klavier vorhanden, das zu spielen er perfekt verstand. So konnte er sich nur mit der Klarinette beschäftigen, und da bestanden seine Übungen einzig darin, verschiedene Tonleitern oftmals, fast schon störend, hinauf- und hinabzuspielen. Mit dem Klavier- oder Akkordeonspielen musste Paul Braun noch Jahre zuwarten. Darunter schien er sehr zu leiden. Sobald Töne der Klarinette aus dem Gemeinschaftsraum ertönten und Hans wie auch Erika diese vernahmen, schlichen sie dorthin. So leise wie möglich öffnete Hans die Türe einen Spaltbreit. Nun konnten sie Herrn Braun bei seinen Übungen zusehen. Allzu gerne hätte Hans wenigstens einmal in dieses Instrument geblasen, aber wie hätte er dies bewerkstelligen sollen? Er hätte es dann versuchen können, wenn Herr Braun für kurze Zeit den Raum verließ. Er getraute sich aber nicht. Was also lag näher, als seine damals von ihm noch sehr leicht beeinflussbare Schwester zu diesem Unterfangen anzustiften? Die Gelegenheit dazu sollte sich schon bald ergeben. Herr Braun hatte, um das WC aufzusuchen, den Raum verlassen. Diese Zeitspanne nutzte Hans und schickte Erika hinein. Zuvor trug er ihr auf, unbedingt in die Klarinette zu blasen. Erika ging auf das auf dem Tisch abgelegte und über dessen Kante hinausragende Instrument zu. Ihr Kopf reichte gerade über die Tischkante. So gut sie es vermochte, blies sie hinein. Kaum, aber dennoch, war ein leiser Ton, den man eher als ein Quietschen benennen sollte, vernehmbar. Wesentlich lauter hingegen war das Donnerwetter, welches Herr Braun, mittlerweile hinter Hans wieder in den Raum zurückgekehrt, auf die Kinder niederließ. Erschreckt rannten diese in ihr Zimmer zurück.
Für den Brückenschlag von Herrn Braun zu Dorothea war alleine Erika verantwortlich. Herrn Braun musste Erikas Erschrockenheit mehr als die des Knaben beeindruckt und sie ihm hinterher erbarmt haben. Bei der nächsten Begegnung mit ihr lud er sie ein, mit ihm einen nahe gelegenen Eissalon auf der Praterstraße aufzusuchen. Erika willigte sofort ein, und schon machten sich beide auf den Weg dahin. Dort angekommen fragte er sie, ob sie gerne ein Eis haben möchte und wie viele Eislutscher sie haben möchte. Sie nickte heftig und hielt ihm alle zehn Finger entgegen. Belustigt über der Kleinen Gebaren kaufte er ihr tatsächlich mehrere dieser beliebten Wassereislutscher. Sie waren mit Zitronen- und Himbeergeschmack für wenige Groschen zu haben. Der Anzahl wegen, die ihre kleinen Händchen unmöglich halten konnten, half er ihr, diese zu tragen. Nun schlenderten sie langsam wieder dem Heim zu. Nach einer Weile kamen sie, teils bekleckert und mit verklebten Händen, an. Dorothea, die mittlerweile vergeblich nach Erika Ausschau gehalten hatte und sie jetzt mit dem ihr fremden Mann daherkommen sah, begann umgehend, mit beiden arg zu schimpfen. Jene wiederum versuchten sich zu verteidigen, wobei Herr Braun von Erika kräftig unterstützt wurde. Nach einigem Hin-und-her-Gerede, bei dem einer den anderen kaum verstand und zu Wort kommen ließ, begannen mit einem Mal alle zu lachen. Dieses allererste Zusammentreffen von Dorothea und Herrn Braun, von dem sie mittlerweile erfuhr, dass er gleichsam Heimbewohner war, führte 1952 zu deren Eheschließung. Die Ehe hielt bis zu seinem viel zu früh eingetretenen Tod, welchen ein Nierenkrebsleiden verursacht hatte. So musste er mit nur dreiundfünfzig Jahren und nach so viel Durchgestandenem von dieser Welt gehen.
Paul Braun, Jahrgang 1907, und sein Bruder Otto, Jahrgang 1897, stammten aus einer gutbürgerlichen, assimilierten jüdischen Kaufmannsfamilie. Nahe dem Wallensteinplatz in der Wallensteinstraße hatten sie eine große Patrizierwohnung bewohnt. Vater Moritz Braun besaß und betrieb in derselben Straße ein Textilgeschäft, in dem er einige Angestellte beschäftigt hatte. Das Geschäft war auf Maßanfertigung von Herrenhemden spezialisiert. Davon konnte die Familie ausgezeichnet leben. Es lief so gut, dass Vater Braun seinen Söhnen eine ausgezeichnete Ausbildung bieten und sich die Familie sogar eine Haushälterin leisten konnte. Schon daran war ersichtlich, dass sie gut situiert waren. Mutter Olga Braun, sie hieß mit ledigem Namen Sucharipa, und ihrem Gatten Moritz war es vergönnt, altersbedingt in Wien sterben zu dürfen. Moritz Braun starb 1936, seine Gattin 1940.
Die Pflichten der Haushälterin bei Familie Braun waren, sich um den Haushalt im Allgemeinen und um die Erziehung des Nachzüglers Paul im Besonderen zu kümmern. In den seltensten Fällen stammten diese „Perlen“, man titulierte sie so, wenn man mit ihnen mehr als zufrieden war, nicht aus der Tschechoslowakei. Es waren einfachste, herzensgute, immer arbeitswillige, oft dem Bauernstand entstammende Mädchen, die sich in der Kaiserstadt Wien, aber nicht nur da, verdingten. Manche von ihnen träumte davon, in dieser multikulturellen Vielvölkerstadt ihrem Prinzen fürs spätere Leben zu begegnen. Viele dieser auf solche Art träumenden, meist naiven Mädchen reisten jedoch nach einiger Zeit sehr traurig und enttäuscht, mit einem ledig geborenen Kind im Arm, in ihre tschechoslowakische Heimat zurück. Manche Mädchen mussten häufig, oft zu spät, die Erfahrung machen, dass ihr vermeintlicher Prinz, den sie kennengelernt hatten, nicht das war, was er vorgab zu sein, sondern Chauffeur, einfacher Soldat, Bediensteter oder gar nur ein fescher, dahergelaufener Charmeur, der zudem niemals ans Heiraten dachte, weil er meist schon verheiratet war.
War so eine „Perle“ bei einer Familie engagiert und beide Seiten miteinander zufrieden, identifizierte sie sich alsbald vollends mit der Familie. Dann wurden die „Perlen“ aber auch wie Familienmitglieder behandelt. Nicht selten blieben sie Jahrzehnte beisammen, und manche heirateten deshalb nie. Die meisten Mädchen waren streng katholisch, gingen ihrem Glauben gesittet nach und störten sich an der ihnen fremden Glaubenszugehörigkeit mancher ihrer Arbeitgeber überhaupt nicht. Brauns „Perle“ wurde Nana gerufen. Mit richtigem Namen hieß sie Julie Mytyzek. Paul Braun, den Hans und Erika vom Anfang ihres Zusammenlebens immer Onkel Paul nannten, sprach, wenn das Thema auf Nana kam, stets in schwärmerischer Ehrfurcht von ihr. Nana besuchte jeden Sonntag ihre Kirche, während Brauns zum Sabbat nur sporadisch eine Wiener Synagoge aufsuchten. Jeder respektierte den Glauben des anderen. Nana war eine hervorragende Köchin und mit ihrer Braun-Familie derart verbunden, dass sie zu denjenigen gehörte, die nie ans Heiraten dachten. Nana war 1946, ein Jahr nach Kriegsende, in Wien verstorben.
Um den tristen, immer gleichen Tagesabläufen im Heim wenigstens für Stunden entfliehen zu können, hielt es Dorothea oft so, dass sie mit den Kindern den Wiener Stadtpark aufsuchte. Sobald sie dies im Sinne hatte, kleidete sie die beiden so adrett wie möglich. Das Trägerröckchen Erikas und die Trägerhose von Hans bestanden aus ausrangierten, weißen Leintüchern, die Dorothea selbst von Hand angefertigt hatte. Erikas blondes Haar schmückte sie zudem mit einer übergroßen farbigen Haarschleife, welche sie um ein lustig nach oben stehendes Haarbüschel gebunden hatte. Hans bekam von ihr einen artig gekämmten Scheitel verpasst, der von ihr Lausallee genannt wurde. Neben dem Stadtpark wurde von ihnen für Spaziergänge gerne auch das weitläufige Pratergelände aufgesucht. Dort durften ihre Kinder, vorausgesetzt immer in Sichtweite ihrer Mutter bleibend, mit anderen Kindern spielen. Waren sie im Stadtpark, schlenderten sie meist bis zu Hübners Kursalon [29]. Vor diesem waren Parkstühle aufgestellt. Waren sie dort angelangt, suchte sich Dorothea einen geeigneten Stuhl aus und nahm darauf Platz. Den Parkstühlen gegenüber befand sich ein halb offener Pavillon. Bei schönem Wetter spielte in diesem ein kleines Orchester auf. Sobald die Musiker unter Stabführung eines Dirigenten zu spielen begannen, waren die Parkstühle gebührenpflichtig. Befugte Personen gingen zu jedem, der Platz genommen hatte, und kassierten eine Musikschutzgebühr. Während der dargebrachten Operetten- und Schlagermelodien schwelgte Dorothea in Erinnerung an Vorkriegszeiten.
Beim Hin- wie auch beim Rückweg in den oder aus dem Stadtpark mussten sie unweigerlich an unzähligen, an den vielen Eingängen stehenden Männern vorbeigehen. Jene Männer wurden Schleichhändler genannt. Es waren ausschließlich Männer, bei denen es sich wenigstens am Anfang vom Kriegsende ausschließlich um Kriegsversehrte gehandelt hatte. Aus erlauschten, zwischen Erwachsenen geführten Gesprächen erhaschte Hans, dass man von diesen für viel Geld, am besten für US-Dollar, amerikanische Zigaretten wie „Lucky Strike“, „Chesterfield“, „Marlboro“ oder „Camel“, aber auch schon die von der Damenwelt so sehr begehrten, noch mit aufreizender Naht versehenen Nylonstrümpfe kaufen konnte. Mit dem Ausüben dieser streng verbotenen Tätigkeit bestritten sie ihren Lebensunterhalt. Es war für sie die einzige Möglichkeit, an Bargeld zu kommen. Alle waren ehemalige Kriegsteilnehmer oder Zivilisten, die durch Kriegsereignisse körperlichen Schaden erlitten hatten. Da fehlte dem einen ein Bein bis hin zum Oberschenkel. Den noch vorhandenen Stumpf platzierte er gekonnt auf eine seiner beiden Stützkrücken, um ihn für die Vorbeimarschierenden gut sichtbar zu machen. Dadurch erhoffte er, mehr Mitleid zu erregen und mehr verkaufen zu können. Andere mit gleicher Verstümmelung, die aber nichts anzubieten hatten, bettelten um Almosen. Einem weiteren Mann fehlte ein Arm, einem neben diesem stehenden ein Auge, über dessen Hohlraum eine schwarze Augenklappe gebunden war. Bedauernswert war auch einer, der sichtbar einen Kopfschuss abbekommen und diesen überlebt hatte und etwas abseits stand. Solch einem Mann in sein durch mehrere Notoperationen fürchterlich entstelltes Gesicht zu sehen, erforderte große Überwindung. Die meisten Vorbeigehenden wandten ihren Blick von diesen Männern umgehend ab. Unter den Schleichhändlern gab es weitere, die beide Beine verloren hatten oder gelähmt waren. Jeder von denen saß in einem dreirädrigen, mit Armeskraft fortzubewegendem Invalidenfahrzeug. In einer Reihe nebeneinander standen diese Gefährte, und deren Insassen boten dieselben Waren wie ihre nebenan stehenden Leidensgenossen an oder bettelten um Almosen. Um die erstmals noch spärlich von amerikanischen Soldaten nach Europa mitgebrachten Nylonstrümpfe gab es ein regelrechtes „G’riss“ (Gerangel). Derweil konnten sich diese, des allzu hohen Preises wegen, die allerwenigsten daran Interessierten kaufen. Gesprochen wurde jedoch viel über diese von der Damenwelt so sehr begehrte Beinbekleidung.
Das Verhältnis zwischen Dorothea, Onkel Paul und den Kindern wurde ein immer engeres. Man unternahm vieles gemeinsam, wobei beider Erwachsenen Liebe zur Musik, besonders zur klassischen, ein wesentlicher Anknüpfungspunkt und nie versiegender Gesprächsstoff war. Eines Tages war es so weit. Onkel Paul zog zu ihnen in das ihnen zuletzt von Frau Citron zugewiesene, etwa dreißig Quadratmeter große Zimmer.
Sehr selten, weil nur dann, wenn ermäßigte Karten zu Nachmittagsvorstellungen angeboten wurden, suchte Dorothea für zwei Stunden dem tristen Alltagstrott auszuweichen. Dann suchte sie ein Kino auf. Häufig waren es alte Revue- oder Kulturfilme, die an Nachmittagen sehr oft in der Wiener Urania, aber auch in anderen Kinos zu sehr günstigen Kartenpreisen angepriesen wurden. Selten ging sie alleine dahin. Sie nahm stets eines ihrer Kinder als Begleitung mit. Einmal mit Hans als Begleitung besuchten sie eine Nachmittagsvorstellung im Tabor-Kino [30]. Es wurde die verfilmte russische Oper „Boris Godunow“ [31] mit bedeutenden Sängern gezeigt. In dieser Vorstellung, die sie am frühen Nachmittag besuchten, waren ausnehmend wenige, vielleicht an die zwanzig Besucher auszumachen. Mit Bestimmtheit setzten diese sich ausschließlich aus Opernliebhabern zusammen. Im großen Kinosaal verloren die sich regelrecht. Dorothea und Hans bezogen ihre Plätze und stellten fest, dass sie in ihrer Reihe alleine waren. Genau in der Reihe vor ihnen saß eine Dame gleichfalls alleine. Ehe das Licht verlöscht war, erkannte Dorothea, dass jene Dame die weltbekannte Opernsängerin Ljuba Welitsch [32], DIE Salome in Richard Straussʼ gleichnamiger Oper, war. Dorothea sprach sie umgehend in deren bulgarischer Muttersprache an. Beide Frauen drückten ihr Bedauern darüber aus, dass so wenige Zuseher Interesse an diesem tollen Opernfilm bekundeten. Nach der Filmvorführung, die beide Damen viel mehr als Hans begeisterte, plauderten sie noch eine Weile recht angeregt miteinander. Ehe man schlussendlich auseinanderging, wurden gegenseitig gute Wünsche ausgetauscht.
6. Hans wurde eingeschult
Hans war ins schulpflichtige Alter gekommen. Er wurde aufgefordert, die Volksschule in der Kleinen Pfarrgasse zu besuchen. Bis es so weit war, oftmals noch danach, hatte Dorothea unzählige Scherereien mit und auf diversen Ämtern zu bewältigen. Von diesen wurde sie aufgefordert, den Beweis vorzulegen, dass sowohl Hans wie auch Erika ihre Kinder seien. Dies, ohne nur irgendein Dokument zu besitzen, einem österreichischen Beamten zu erklären, war ein absolut aussichtsloses Unterfangen. Wie sie dies dennoch jeweils schaukeln konnte und hinbekam, ist und bleibt rätselhaft. Es sollte noch Jahre dauern, bis die Kinder von Amts wegen als die ihr gehörenden anerkannt und zu Österreichern erklärt wurden. Bis dahin waren Hans und Erika in allen provisorisch ausgestellten Notdokumenten, auch in ihren Schulzeugnissen, als staatenlos geführt worden. An den ersten Schultagen bat Dorothea Onkel Paul, Hans seinen zukünftigen Schulweg zu erklären und ihn dahin zu begleiten. Seine Schule befand sich in unmittelbarer Nähe des Augartens.
Nun war es so weit, und der erste Schultag stand an. Erika ließ sich unter keinerlei Ablenkungsversuchen davon abbringen, ihren Bruder zur Schule zu begleiten. Also machten sie sich zu dritt auf den Weg. Bei der Schule angekommen, drängte sich Erika hinter Hans bis in dessen Klassenzimmer hinein. Sie war der Grund dafür, dass die allererste Unterrichtsstunde erst mit einer kleinen Verspätung beginnen konnte. Nur mit leichter Gewaltanwendung und unter Tränenvergießen Erikas war sie zum Verlassen des Klassenraumes zu bewegen. Alle Klassenkameraden wie auch die Lehrerin lachten, während Hans sich wegen seiner um ihn sich ängstigenden Schwester fürchterlich schämte. Alsbald ging er seinen Schulweg alleine.
Der dem Knaben schnell zur Routine gewordene Schulweg führte von der Tempelgasse am Nestroy-Kino [33] vorbei. Von da musste er über die Praterstraße hinüber und in die Komödiengasse hinein. An der rechten Gassenecke stand das einst weithin berühmte, vor geraumer Zeit zur Ruine zerbombte Carltheater [34]. Die Komödiengasse ging er bis zur Großen Mohrengasse hoch, in welcher das Spital der Barmherzigen Brüder steht. Von hier musste er rechts in die Schmelzgasse einbiegen. In dieser Gasse befand sich, wie anfangs linker Hand in der Komödiengasse, ein weiterer „Branntweiner“ (kleines Lokal, in welchem Hochprozentiges ausgeschenkt wurde) sowie andere Geschäfte. Nachdem er auch diese Gasse durchschritten hatte, kam er zur quer verlaufenden Taborstraße. In dieser Straße befanden sich mehrere Schuhgeschäfte. Eines davon nannte sich nach der Besitzerfamilie „Honsal“. Der Sohn dieser Familie war Klassenkollege von Hans. Ebenso der Sohn der Inhaber der Drogerie „Scherk“, welche sich gleichfalls in der Taborstraße befand. Diese überquerte er, um sie bis zur Augartenstraße entlangzugehen. Hier angelangt, schwenkte er in die erste linke Seitengasse, welche bereits die Kleine Pfarrgasse war, ein. Nun waren es nur noch wenige Schritte an einigen Häusern vorbei, und seine Volksschule, die sich auf der gegenüberliegenden Seite befand, war erreicht. Dieses Gebäude unterschied sich von den anderen, die ebenso verstaubt und grau waren, überhaupt nicht. Einzig dadurch, weil davor, am Gehsteig, ein eisernes Schutzgitter für ungestüm herauslaufende Schüler angebracht war. An speziellen Feiertagen unterschied es sich auch noch dadurch, dass dann von einer über dem ersten Stock angebrachten Wandhalterung eine rot-weiß-rote Fahne herabhing.
Der Schuldirektor, Wenzel mit Namen, trug immer einen – vielleicht seinen einzigen – grauen Anzug mit dazugehörigem Gilet. In dessen einer Tasche steckte eine Taschenuhr. Deren Sicherheitskette war so platziert, dass sie jeder sehen konnte. Das Antlitz des Direktors zierte ein weißer Kinnbart, wie ihn viele Männer seiner Generation gerne trugen. Ab und zu zeigte er sich im Klassenzimmer, um ein paar Worte mit der Lehrperson, jedoch nie mit Schülern, zu wechseln, die sich ohnehin scheuten, ihm zu begegnen oder ihm gar von Antlitz zu Antlitz gegenüberzustehen. Er war und blieb eine unnahbare Person. In jedem Klassenzimmer waren über dreißig Schüler untergebracht. Der Großteil gehörte dem katholischen, der Rest den evangelischen Glaubensbekenntnissen an. Beim Namen Gamliel war im Klassenbuchverzeichnis unter Religionszugehörigkeit das Wort „mosaisch“ eingetragen. Mit dieser Bezeichnung wusste keiner der Schüler etwas anzufangen oder diese zu deuten. Sobald die Schüler am Morgen ihre Plätze eingenommen hatten, fing jeder Schultag mit dem monotonen, von der Lehrperson geleiteten Herunterleiern des Vaterunsers an. Derweil hatten die Knaben ihre Blicke auf das an der Frontwand des Klassenzimmers angebrachte Holzkreuz zu richten. Dieses schloss sich an das Foto des damaligen Bundespräsidenten Dr. Karl Renner an. Diese Fotografie zierte ein ähnlicher Kinnbart wie jener des Schuldirektors. Hans, dem anfänglich nichts Gegenteiliges aufgetragen wurde, betete mit, und wie es scheint, hat er bis heute keinerlei Schaden davon getragen. Bald wurde er aufgefordert, den jüdischen Religionsunterricht zu besuchen. Dieser fand stets an Nachmittagen in einer anderen Volksschule, nämlich in der Novaragasse, nahe dem Praterstern, statt. Befand Hans sich in seiner Volksschule, musste er während der christlichen Religionsstunde ein anderes Klassenzimmer aufsuchen und am dort stattfindenden Unterricht teilnehmen.
In den Klassenzimmern standen, durch einen Mittelgang getrennt, zwei Reihen hölzerner Bänke, die mit ebensolchen Pulten fest miteinander verbunden waren. Fanden in den einen Bankreihen je drei Schüler nebeneinander Platz, konnten in der anderen, noch etwas breiteren, gar vier Platz nehmen. Das anfängliche Schreiben wurde mit Blei- und Buntstiften gelehrt. Später wurde auf einen Federstiel mit einsetzbarer Stahlfeder übergegangen. Dafür war am oberen Pultende für jeden Schüler ein mit schwarzer Tinte aufgefülltes, offenes Tintenglas in das Pult integriert. Befand sich die Tinte längere Zeit im Glas, begann sie sich nach dem Eintauchen der Schreibfeder beim Herausziehen wie ein dünner, lang gezogener Gummifaden zu ziehen. Sowie der Faden abriss, hinterließ er einen sich über das Pult, oft auch über das auf diesem liegende Heft ziehenden schwarzen, dünnen Strich. War dieser Fall eingetreten, musste dem Schulwart Meldung gemacht werden. Nach Unterrichtsschluss leerte und säuberte er alle Tintengläser und füllte sie mit frischer Tinte auf.
Alle Räumlichkeiten im Schulgebäude waren mit grobflächigem Parkett ausgestattet. Täglich wurde dieses vom Schulwart nach Unterrichtsschluss gekehrt und an Wochenenden mit stark riechendem, schwarzfarbenem Öl eingelassen. Sobald die Böden das Öl aufgesogen hatten, streute er Sägespäne darüber, um das überschüssige Öl aufzusaugen und hernach wegzukehren. Beheizt wurden die Klassenräume von schwarzen, gusseisernen Öfen. Allmorgendlich, schon lange vor Unterrichtsbeginn, heizte sie der Schulwart an. Zwischendurch machte er während der Unterrichtszeiten einen kontrollierenden Rundgang, um nach den Öfen zu sehen. Schüler, welche von daheim Äpfel für das Pausenmahl mitbekommen hatten, durften diese, so sie mochten, auf der heiß gewordenen Ofenplatte anbraten lassen. Dann begann sich ein süßschwerer, von Minute zu Minute intensiver riechender Duft im Klassenraum auszubreiten. Hans kam nie in den Genuss, einen Apfel mitzubekommen. Die Gründe dafür finden sich schon oftmals zuvor erwähnt. Seinen Mitschülern war er deren Äpfel nicht neidig, roch den Duft jedoch gerne. Hans kannte kein Neidgefühl und das Wort Neid als Wort nur aus dem Wörterbuch. Jahre später lernte er das Neidgefühl als häufige, ihm bis heute nicht verständliche Eigenschaft viel zu vieler Mitmenschen kennen.
Aus einer Parallelklasse tat sich nach Unterrichtsschluss des Öfteren ein Schüler bei seinen Mitschülern dadurch hervor, dass er schwächer Aussehende aus anderen Klassen anpöbelte. Liebend gerne zettelte er dann Raufhändel an. Er war jeweils darauf bedacht, hinter sich einen Großteil seiner Klassenkameraden zu wissen. Jene, die ihn, seine Veranlagung und sein Vorhaben bestens kannten, feuerten sein Tun lauthals an. Sein beliebtestes Angriffsziel war das sehr dünne Bürschchen Hans. Unter den allermeisten Schülern war es üblich, dass man sich wohl duzte, jedoch mit Familiennamen ansprach. Manche Familiennamen wurden aus verschiedensten Eingebungen verkürzt oder verlängert oder auch umgemodelt. Keinem Namensträger machte es etwas aus, mit der Verballhornung seines Namens fortan gerufen zu werden. Hans ging es nicht anders. Auch er war davon nicht verschont geblieben. Anstatt Gamliel wurde er seiner Dünnheit wegen anfangs „Gandhi“, bald aber „Gami“ gerufen. „Gandhi“ bestimmt deshalb, weil der Name offenbar einfacher als Gamliel auszusprechen war. Darüber hinaus verging zu jener Zeit kein Tag, ohne dass in den Radionachrichten nicht mehrmals der Name des großen, für die Selbständigkeit seines Landes friedlich kämpfenden Inders genannt wurde.
Vielen Anpöbelungen konnte Hans sich durch rasches Davonlaufen entziehen, war er doch einer der schnellsten Knaben, wenn im Turnunterricht Wettläufe angesagt waren. Eigenartig dünkte es Hans, dass er, wenn er dem Stänkerer alleine begegnete, von diesem ungeschoren gelassen wurde. Fast hatte es den Anschein – jener tat wenigstens so –, als kenne er Hans überhaupt nicht. Umso aggressiver tat er sich im Kollegenkreis hervor.
Vis-à-vis der Schule befand sich ein Platz, an dessen linker Seite die Leopoldskirche stand. An beiden vorderen Kirchenecken waren zwei Nischen, in welchen je eine Heiligenfigur, mannshoch aus Kalkstein gehauen, auf einem aus ebensolchem Material bestehenden Sockel stand. Gelang Hans die Flucht aus irgendeinem Grund nicht so rasch wie beabsichtigt und wurde er deshalb von seinen Verfolgern eingeholt, achtete er sein Heil im Erreichen einer der beiden Nischen zu finden. Sobald er eine erreicht hatte, stellte er sich so hinein, um wenigstens seinen Rücken gedeckt zu wissen. So platziert, konnte er sich dann immer erfolgreich der mit Holzlinealen ausgeteilten Hiebe erwehren und mit seinem Lineal sogar Verteidigungshiebe austeilen. Jahre später vermutete Hans, dass ihn der hinter ihm auf dem Sockel stehende Heilige jedes Mal vor der Übermacht der Angreifer beschützt hatte. Ob dieser Heilige wusste, welcher Religion Hans angehörte? Vielleicht wusste es jener, und Hans stand gerade deshalb unter dessen besonderem Schutz? Jedenfalls konnten ihm, so geschützt, die Angreifer nie oder kaum etwas anhaben. Nach etwa halbstündigem Hin-und-her-Schlagen, bei dem Hans niemals verletzt worden war, zog es ein Knabe nach dem anderen vor, den Heimweg anzutreten. Letztlich konnte auch Hans nach Hause eilen.
Einmal trat tatsächlich der Fall ein: Hans gelang es nicht, rasch davonzulaufen, um die rettende Nische zu erreichen. Im Nu war er von der ihm wohlbekannten Meute umzingelt. Mit ihm im Kreis befand sich ihr laut maulender Anführer. Mit allen möglichen Mitteln versuchte dieser, Hans zu provozieren. Hans, innerlich angstvoll, sich nach außen sehr gelassen gebend und scheinend, stand ruhig da. Er wartete darauf, wie sich die Situation diesmal entwickeln würde. Insgeheim hoffte er, doch noch einen Fluchtweg auszumachen. Sein Gegenüber sah nicht nur so aus, sondern war wesentlich kräftiger und korpulenter. Die Spannung vor der jeden Augenblick losgehenden Balgerei schien kaum mehr steigerungsfähig. Angesichts der ihn umgebenden Übermacht knallte Hans urplötzlich, mit der Kraft und dem Mut der Verzweiflung, seinem Kontrahenten einen geschwungenen, weit ausgeholten, klassisch ausgeführten Haken in dessen Magengegend. Obschon er nicht zielte, traf er punktgenau. Es war, wie man in der Boxersprache zu sagen pflegt, ein „Lucky Punch“ [35]. Im selben Augenblick begann der Getroffene, mit schmerzverzerrtem Gesicht Wehlaute auszustoßen. Dabei krümmte er sich und setzte sich auf den Boden. Mit einem Male öffnete sich der Hans umzingelnde Kreis. Eine Unzahl weit aufgerissener Augen und Mäuler war nicht auf den Stänkerer, sondern auf Hans gerichtet. Mit bedachten Schritten, dabei seine Gegner im Auge behaltend, verließ er den nun offenen Kreis. Diese Wendung der von den umherstehenden Knaben so sehnlichst erwarteten Schlacht hatte keiner, selbst Hans nicht, erwartet. Derweil saß der Rädelsführer immer noch jammernd auf dem Boden. Einer seiner Kameraden besann sich, rannte ins Schulhaus zurück und berichtete seiner Klassenlehrerin auf seine Weise, und bestimmt auch im Sinne des Rädelsführers, vom eben Vorgefallenen. In deren Begleitung kam er zu den auf dem Pfarrplatz durcheinanderschreienden und gestikulierenden Knaben zurück. Gemeinsam machten sie sich daran, nach Hans Ausschau zu halten. Der war mittlerweile weit weg und hatte sich hinter ein Haustor begeben. Von dort aus konnte er die ihn Suchenden halb ängstlich, halb belustigt beobachten. Nach einer Weile wurde die Suche nach ihm aufgegeben.
Tags darauf wurde Hans zuallererst von Frau Baumgartner, seiner Klassenlehrerin, zur Rede gestellt. Er merkte sofort, dass sie seine Darstellung des Vorgefallenen nicht glaubte und ihm nicht einmal zuhörte. Für sie war Hans von vornherein der Schuldige. Vergeblich versuchte er, den Sachverhalt wahrheitsgemäß darzustellen. Hans begriff es nicht, dass seine Lehrerin nicht seinen, sondern der anderen Ausführungen glaubte. Wie heißt es doch so oft: „Schuld ist immer der Jud’.“ Sie bestrafte ihn mit einer Eintragung ins Klassenbuch, einer Verschlechterung seiner Betragensnote, die bis anhin immer sehr gut lautete, und mit einer überlangen Schreibarbeit. Zudem musste Hans einen Nachmittag einige Stunden nachsitzen und eine weitere ihn strafende Schreibarbeit ausführen. Nebenher ging von der Lehrerin eine Mitteilung an seine Mutter. Diese eigenartige Rechtsprechung leuchtete ihm nicht und nicht ein. Er war sichtlich enttäuscht. Alleine seine Mutter glaubte ihm, unterließ es aber aus ihrem nicht geäußerten, sicherlich wohlbedachten Grund, bei der Lehrperson vorzusprechen. Allerdings, die Episode hatte eines bewirkt: Hans war seither nie mehr angepöbelt worden, im Gegenteil. Hans meinte zu erkennen, dass manch einer seiner ehemaligen Gegner seither mit hintangehaltener Achtung gar einen Bogen um ihn machte.
Hans liebte es, nach Unterrichtsschluss nicht direkt, sondern auf weitläufigen Umwegen durch die engen, alten Gassen der Leopoldstadt heimwärts zu schlendern. Dies tat er dann, wenn er daheim nicht von Mutter erwartet wurde. Beim Dahin- und Umherschlendern, manchmal begleitete er einen Klassenkameraden zu dessen Wohnhaus, lernte er im wahrsten Sinne des Wortes einen Großteil des Bezirkes genauer kennen. Alle Läden und Geschäfte wurden von ihm betrachtet. Er sah sich an den ausgestellten Waren satt, träumte oder wünschte sich, dann und wann dies oder jenes zu besitzen. Dies besonders, wenn er an einem Spielwarenladen ankam, vor welchem er dann jeweils länger verweilte.
Sich in Wien zu verirren war unmöglich. An jeder Straßen- und Gassenecke war deren Name deutlich lesbar in der Höhe des ersten Stockwerkes angebracht. Obendrein waren an jedem Haus oberhalb des Haustores die Hausnummer und unter dieser abermals der Name der Straße oder Gasse angegeben. So kurze Zeit nach Kriegsende waren an sehr vielen Hauswänden noch große Buchstaben wie LSK (Luftschutzkeller) oder LSR (Luftschutzraum) und andere Hinweise und noch größere Richtungspfeile schon von Weitem erkennbar. Sie waren mit breitem Malerpinsel in weißer Kalkfarbe hingepinselt worden. Während der Kriegszeiten sollten diese Zeichen, für die Bevölkerung deutlich sichtbar, auf vorhandene Schutzräume oder offen stehende Keller hinwiesen. All diese Räumlichkeiten boten mehr oder weniger Schutz, befanden sich unter dem Straßenniveau und sollten bei Fliegeralarm aufgesucht werden.
Auch der unzählig vorhandenen Durchgangshäuser wegen, welche einen Gassenzug mit einem parallel laufenden verbanden, lohnte sich für Hans das Durchstreifen seines Bezirkes. Bei derlei Streifzügen konnte er hin und wieder die „Vier im Jeep“ auf deren Kontrollfahrten erblicken. Die „Vier im Jeep“ waren Soldaten der vier Besatzungsmächte. [36] In sauberster Montur und gewaschenem Wagen befuhren sie Wiens Straßen. In festgelegten Zeitabschnitten lenkte jedes Mal ein anderer Soldat das Gefährt. Am imponierendsten stach Hans jener Soldat einer Westmacht ins Auge, dessen Uniformjacke zusätzlich mit dicken weißen Kordeln bestückt war. Auch das Kennenlernen der unmittelbaren Umgebung des Heimes war für ihn von Vorteil, nämlich dann, wenn er mit anderen Knaben „Räuber und Gendarm“ spielte. Die Durchgangshäuser boten unzählige Möglichkeiten, sich beim Spielen zu verstecken. Häufig bargen jene Bauten gleich mehrere Innenhöfe. In manchen roch es muffig-säuerlich. Warf Hans beim Durchstreifen seinen Blick in diese oder jene Ecke, sah er, dass manch Nachtschwärmer dort seine Notdurft hinterlassen hatte. Es dauerte jeweils Tage, ehe jemand sich die Mühe machte, den Unrat wegzukehren. Zur Sommerzeit war der Gestank des nicht rasch beseitigten Unrates kaum auszuhalten. Sobald er an solchem vorbei musste, hielt er so lange seinen Atem an, bis er daran vorbei war.
In manchem Innenhof hatten geschäftstüchtige Bewohner Läden eingerichtet, welche sie als Schneider-, Schuster- oder als Holz- und Kohlenladen betrieben. Jeder Laden bestand aus nur einem stets dunklen Raum, in welchem höchstens eine, nur schwach leuchtende, Birne so viel Licht verbreitete, um halbwegs etwas erkennen und arbeiten zu können. Fast alle Läden wurden von Frauen betrieben. War doch einmal ein Mann der Betreiber, handelte es sich um einen Invaliden. An Plätzen, an welchen Ruinen bereits abgetragen und der Schutt weggeräumt worden war, ließen sich Altwaren- und Eisenhändler nieder. Was dort alles zusammengetragen, ge- und verkauft wurde, würde bei der heutigen Wohlstandsgesellschaft und -generation, die das Leben nur im Genießen und im Überangebot zu leben versteht, ungläubiges Kopfschütteln auslösen. Alles war zu gebrauchen und wieder verwertbar. Oft wurden Sachen zu völlig anderen Zwecken als ursprünglich bestimmt umgemodelt, danach verkauft und verwendet. Beim Kauf durfte man nicht hundertprozentig sicher sein, hin und wieder nicht auch Sore [37] erworben zu haben. Für Hans und Erika gab es zwischendurch Zeiten, in denen sie vom tristen Heimleben befreit wurden. Sowohl die Kultusgemeinde wie auch der linksgerichtete jüdische Verein „Haschomer Hatzair“ [38] (Wächter) organisierten Ferienaufenthalte. Die Vereinigung „Haschomer Hatzair“ hatte, nachdem sie ihre erste Anlaufstelle in der Seitenstettengasse im ersten Bezirk aufgeben musste, in der Alser Straße im neunten Bezirk eine neue Bleibe gefunden. Als sie später auch diese aufgeben musste, fanden sie eine in der Storchengasse im 15. Bezirk. Die vorhandenen Räumlichkeiten wurden den jugendlichen Sympathisanten der „Haschomer Hatzair“ als eine Art Klublokal angeboten, welches gerne besucht und redlich genutzt wurde. Hans kannte von mehrmaligen Besuchen sowohl die Räumlichkeiten in der Alser Straße wie auch jene in der Storchengasse. Gerne nahm er die Gelegenheiten wahr, um mit Gleichaltrigen bei verschiedenen Spielen sowie an interessanten Diskussionen teilzunehmen. Den Leitern dieses Vereins stand im Sinne, in jüdischen Kindern die Begeisterung zu wecken, nach Israel, dem Gelobten Land, auszuwandern und dort am Aufbau des neu gegründeten jungen Staates mitzuwirken. Der in Wien ansässige Verein unternahm sehr viel mit den lebenshungrigen, jüdischen Kindern. Dessen Gruppenleiter wurden ihres Einfühlungsvermögens wegen von allen geliebt. Hans verbrachte wunderschöne Ferienwochen in einem von der „Haschomer Hatzair“ organisierten Jugendlager in Adelboden in der Schweiz. Ein weiteres Mal ebenso schöne Zeiten in Edlach an der Rax in Niederösterreich. Aus beiden Zeiten nahm er unauslöschbare Erinnerungen mit, schloss Freundschaften, die bis heute bestehen. Während der großen Sommerschulferien ermöglichte es die Wiener Israelitische Kultusgemeinde jüdischen Kindern, einige Wochen lang in einem Heim in Haag 54 bei Neulengbach im schönen Niederösterreich zu verbringen. Bei den von der „Haschomer Hatzair“ organisierten Ferienaufenthalten war Erika, weil noch zu klein, nie dabei, in Neulengbach jedoch immer. Die Wochen in Neulengbach genossen nicht nur Hans und seine Schwester im Kreise weiterer Kinder, sondern in Wien auch Dorothea und Onkel Paul. Das Kinderheim in Haag befand sich in einem riesigen Garten. Von außen war der Garten von einer Maschendrahtumzäunung umgeben. An dessen Innenseite waren ringsum mannshohe, uneinsichtige Haselnusssträucher und anderes Buschwerk gesetzt. Das Heim selbst umgab eine große Rasenfläche, die wiederum durch einige Maulbeerbäume mit herrlich schmeckenden Früchten und einer in einem Eck befindlichen Sportanlage unterbrochen war. In einem Teil der Liegenschaft stand ein großer Heuschupfen, welcher bis fast obenhin mit Heu aufgefüllt war. Knaben, die dies entdeckt hatten, kletterten in diesem so weit wie nur möglich nach oben, um hinterher ins weiche Heu hinabzuspringen. Nicht weit vom Heuschupfen war die Möglichkeit vorhanden, in einem nicht allzu großen, etwa einen halben Meter tiefen Bassin herumzuplantschen. Jeder Ferientag wurde abwechslungsreich gestaltet. Es wurden sportliche oder die Geschicklichkeit messende Wettkämpfe veranstaltet oder in den angrenzenden Wald Ausflüge unternommen und lauthals Lieder gesungen. Dazwischen sprangen Kinder, sobald ein Himbeer-, Brombeer- oder Heidelbeerstrauch am Waldrand entdeckt wurde, zu diesem, um sich an den Köstlichkeiten zu laben. Während der Aufenthaltswochen gab es keinen einzigen Augenblick, in dem Langeweile aufgekommen wäre. Die vielerlei Veranstaltungen wurden einzig durch anfallende Mahlzeiten, die im Heim eingenommen wurden, unterbrochen.
Nach dem morgendlichen Aufstehen, noch vor dem Waschen und dem Frühstück, mussten alle Kinder nach unten vor das Haus und auf der Wiese antreten. Ein Vorturner zeigte etwa fünfzehn Minuten lang verschiedene Übungen und regte alle an, nachzuturnen. Hernach ging man sich waschen und zum Frühstück. Zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen wurde ein Gabelfrühstück und am Nachmittag eine Jause angeboten. Dann wurden jedes Mal große Tabletts mit riesigen Schwarzbrotscheiben, die nur mit Marmelade bestrichen waren, dennoch köstlich schmeckten, bereitgestellt. Viele Freundschaften wurden geschlossen. Einer der Knaben hieß Julius Neumark. Er hatte die wunderbare Begabung, Geschichten detailreich erzählen zu können. Nicht nur, dass er erzählen konnte, vermochte er seinen Vortrag mit einer derartigen Spannung zu unterlegen, diese nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern noch zu steigern. Deshalb gab es niemals Anstände, wenn es hieß, dass zu Bett gegangen werden musste. Ausnahmslos freuten sich alle Knaben darauf, dass Julius, sobald das Licht gelöscht wurde, mit seiner Erzählung, welche die Nibelungensage war, begann. Jeder Knabe sog die von Julius geschickt in Fortsetzungen eingeteilte Erzählung in sich auf und übernahm sie nahtlos im darauf folgenden Traum.
Über die Ferienorganisationen in Neulengbach hinaus war es der Wiener Kultusgemeinde gelungen, mit einigen jüdischen Gemeinden in der Schweiz Kontakt aufzunehmen. Aufgrund dessen boten dortige jüdische Gemeinden, darunter auch jene in Basel, Familien auf, die gewillt waren, jüdische Kinder aus Österreich für einige Zeit bei sich aufzunehmen und aufzupäppeln. Für Hans und Erika meldeten sich zwei Familien, die sich, es war das Jahr 1948, bereit erklärten, beide bei sich aufzunehmen.
7. Die wunderschöne Zeit in Basel
Hans und Erika kamen in den Genuss, bei zwei im selben Hause wohnenden Familien in der Stadt Basel – es war ein Zweifamilienhaus in der Eichenstraße 27 – aufgenommen zu werden. Die Familie, zu welcher Erika kam, hieß Orzel. Sie setzte sich aus den Eltern und deren beiden Töchtern, die in Erikas Alter waren, zusammen. Es waren sicher sehr liebe Leute, aber das schreckliche Heimweh, von welchem Erika seit ihrer Ankunft in Basel befallen und nicht mehr losgelassen wurde, vermochten sie nicht zu mindern. Daher trat Erika nach nur kurzem Aufenthalt wieder die Rückreise nach Wien an.
Die Patenfamilie von Hans hieß Gradwohl. Diese setzte sich aus Vater, Mutter, der Tochter Marlyse, die im Alter von Hans war, dem etwas älteren Sohn Pierre, der bereits das Gymnasium besuchte, und dem ältesten Sohn Roland, welcher vor der Matura stand, zusammen. Roland ergriff später die Berufe Journalist und Rabbiner und wanderte wie seine Schwester Marlyse, die in späteren Jahren ihren Vornamen auf Emanuelle änderte, nach Israel aus. Pierre machte seinen Doktor, trat aus dem Judentum aus und arbeitete viele Jahre in der Forschungsabteilung eines Schweizer Chemiekonzerns.
Die Gradwohls waren religiöse Juden. Sie versuchten Hans, für den Religiosität absolutes Neuland war, in ihr Leben und dessen täglichen Ablauf mit einzubeziehen. Das fing bereits mit dem Küssen der an den Torpfosten angebrachten Mesusen [39] an und reichte bis zu Leseversuchen in hebräischen Gebetsbüchern. Jeder Sabbat sowie alle jüdischen Feste wurden in der Synagoge begonnen und daheim den Geboten entsprechend fortgesetzt und gefeiert. Nach Synagogenbesuchen erhielten die Kinder bunte Zuckerstangen, die „Mässmoggen“, eine Basler Spezialität, genannt wurden. Im Gegensatz zu Erika gefiel es Hans bei seiner Patenfamilie ausgezeichnet. Zudem verstand sich der Knabe mit Marlyse sehr gut. Außer ihr hatte er im Nachbarhaus einen nicht jüdischen, gleichaltrigen Spielgefährten. Fast täglich spielte er mit diesem auf der kaum befahrenen Straße entweder mit herrlich bunten Glasmurmeln oder sie fuhren auf Dreirädern umher. Im Gegensatz zu Wien, wo alle Straßen und Gassen mit größeren oder kleineren Steinen gepflastert waren, waren in Basel, was Hans sofort aufgefallen war, alle Fahrbahnen asphaltiert.
Die Gradwohls schienen an Hans ebenfalls Gefallen gefunden zu haben. Sein ursprünglich für ein, zwei Monate gedachter Aufenthalt wurde nach Rücksprache mit seiner Mutter auf ein ganzes Jahr verlängert. Ehe seine Pflegeeltern dies arrangiert hatten, mussten sie sich von einem erlittenen Schock erholen und diesen aufklären. Es war kurz nachdem Hans bei ihnen in Basel angekommen war. Frau Gradwohl wollte ihn in der Badewanne gründlich waschen. Deshalb ersuchte sie Hans, sich auszuziehen. Hans legte seine Kleider ab. Er bestieg die mit warmem Wasser gefüllte Wanne. Dann betrat Frau Gradwohl das Badezimmer und wollte den Knaben zu waschen beginnen. Sowie sie seinen nackten Körper überschaute, wich sie, zugleich einen kurzen Schrei ausstoßend, einen Schritt von der Wanne zurück. Während sie ihren erschreckten Blick abermals am Körper von Hans hinabgleiten ließ, sah er sie mit Verständnislosigkeit ausdrückenden, großen Augen an. Endlich schien sie sich gefangen zu haben und fragte Hans in schroff gehaltenem Ton, ob er denn Christ und kein Jude sei? Nun sah Hans Frau Gradwohl verdutzt an. Er verstand absolut nicht, weshalb sie diese Frage an ihn stellte. Wenn er von seiner Mutter auch nicht religiös erzogen wurde, war er sich Jude zu sein immer bewusst. Derweil merkte Frau Gradwohl, so nicht weiterzukommen. Deshalb rief sie ihren in der Stube weilenden Gatten zu Hilfe. Sie wechselten ein paar Worte, und danach trat Herr Gradwohl ebenfalls an die Wanne heran. Nun sah er an Hans Körper hinab. Jetzt fragte er ihn, wieso er nicht beschnitten sei? Die von Herrn Gradwohl an ihn gerichtete Frage konnte Hans nicht einordnen, beteuerte aber, sehr wohl Jude zu sein. Beide Gradwohls sahen ein, mit der Befragung keine sie befriedigende Antwort zu bekommen. Umgehend sandten sie ein Telegramm an seine Mutter. In diesem fragten sie, ob Hans Jude und wenn ja, warum er nicht beschnitten sei? Sowie Dorothea das Schreiben überflogen hatte, antwortete sie postwendend. Ihr Schreiben bestand aus wenigen Fragesätzen. Der Hauptsatz ihrer Gegenfrage war, bei welcher Gestapo-Stelle auf ihrer Flucht gerade vor jenen sie den Antrag zur Beschneidung ihres Sohnes, nach jüdischer Tradition ausgeführt, hätte stellen sollen? Ihre Antwort befriedigte Herrn und Frau Gradwohl. Nach abermaligem Briefwechsel willigte Dorothea selbstverständlich ein, Hans im jüdischen Spital zu Basel der versäumten Prozedur unterziehen zu lassen, die, der erwähnten Umstände wegen, bislang nicht vollzogen werden konnte.
Hans hatte kurz zuvor in Wien bereits den Volksschulalltag kennengelernt. Folglich war er angehalten, auch in Basel die Schule zu besuchen. Kurzum wurde er in eine Volksschule, die in der Schweiz Primarschule genannt wird, eingewiesen. Mit dem Schweizerdeutsch, das der Lehrer und seine Klassenkameraden sprachen, hatte Hans keinerlei Mühe. Er verstand es sofort, tat aber manchmal, besonders beim Spielen, so, als verstünde er manches nicht. Darüber konnten sich seine Gefährten und er selbst köstlich amüsieren. Das in der Schweiz in den Primarschulen praktizierte Schreiben mit Griffel auf Schiefertafel anstatt wie in Österreich mit Bleistift in Hefte war für ihn jedoch neu, doch fiel es ihm nicht schwer. Ein wenig wunderte es ihn schon, denn in Wien hatte er von der ersten Schulstunde an mit Bleistift, danach mit Tintenfeder in ein Heft schreiben zu lernen begonnen. Dieser an und für sich kleine Unterschied sollte Hans zum Nachteil geraten, als er später wieder in Wien zurück in die nächste Klasse aufsteigen hätte sollen. Er musste die Klasse wiederholen, obschon er sie in der Schweiz positiv beendet hatte. Die Begründung des Stadtschulrates auf Nachfrage seiner Mutter war, weil man eben in der Schweiz mit Griffel auf Schiefertafel und nicht mit Bleistift und/oder Feder in Hefte schrieb.
An Sabbatabenden bestand das Abendessen fast immer aus einem sicherlich ausgezeichnet zubereiteten kalten Karpfen in Aspik, einer jüdischen Spezialität, die Hans des Aspiks wegen überhaupt nicht leiden mochte. Wurde solcher aufgetischt, musste er sich ungemein überwinden, die ihm vorgesetzte Portion unter den Blicken aller bei Tisch Anwesenden hinunterzuwürgen. Zu jüdischen Feiertagen wurde Frau Gradwohl bei ihren Arbeiten von zwei nicht jüdischen Fräulein unterstützt. Diese erledigten all das, was Juden an solchen Tagen zu tun verboten war. Selbstverständlich war alles Geschirr im Hause doppelt vorhanden. Es wurde besonders darauf geachtet, dass es stets für fleischige und für milchige Speisen getrennt benutzt und ebenso aufbewahrt wurde. [40]
Bei gelegentlichen Spaziergängen oder Besuchen der Synagoge übten die Basler Taxis eine besondere Faszination auf Hans aus. Die Taxiflotte bestand ausschließlich aus in dunkleren Farben gehaltenen, amerikanischen Automarken. Jeder Taxichauffeur trug eine in gleicher Farbe wie das von ihm gelenkte Fahrzeug gefertigte Uniform mit dazugehöriger Schirmkappe. Dies sah prachtvoll und überaus vornehm aus.
Frau Gradwohl kümmerte sich ausschließlich um den Haushalt und die Kinder. Ihr Mann war wochentags mit seinem beigefarbenen Auto der Marke Ford für eine Textilfirma im Außendienst unterwegs. Hans, der neben dem Schulunterricht sehr viel Freizeit hatte, durfte ihn häufig auf seinen Tagestouren, welche das ganze Baselland mit einbezogen, als Beifahrer begleiten. Wie oftmals zuvor waren sie in ländlicher Gegend unterwegs. Hans fiel diesmal auf, dass Herrn Gradwohls Kopf während der Fahrt in gewissen Zeitabständen immer wieder langsam auf dessen Brust zu sinken begann. Kurz bevor sein Kinn die Brust erreichte, schoss dieser wieder ruckartig hoch. Herr Gradwohl muss sehr müde oder gar krank gewesen sein. Abermals neigte sich sein Kopf gegen die Brust, wobei seine Augen, ehe sie sich für nur kurze Zeit schlossen, einen verklärten Ausdruck hatten. Es war offensichtlich, dass er sich nicht mehr konzentrieren konnte, geschweige noch fähig war, sich länger wach zu halten. Solch ein kurzer Augenblick genügte, dass das schwere Automobil ohne Zutun seines Chauffeurs plötzlich die Landstraße verließ. Der Wagen brach seitlich aus und kam nach etwa zwanzig Metern in einem frisch gepflügten Acker zum Stillstand. Offensichtlich war das Feld erst vor Kurzem gepflügt worden. Wegen der noch hochragenden Schollen und dem tiefen, schweren Boden war die Bremswirkung über das auf den Schollen aufgesessene Chassis zum Glück ziemlich abrupt erfolgt. Im Nu war Herr Gradwohl hellwach geworden. Äußerst erschrocken erfasste er die Situation, in die sie geraten waren. Auch erkannte er nach mehrmaligen erfolglosen Versuchen, retour zu fahren, dass der Wagen festsaß und ohne fremde Hilfe an ein Zurückkommen auf die Landstraße nicht zu denken war. Umgehend eruierte er, welchem Bauern das Ackerland gehörte. Sowie er dies erkundet hatte, begab er sich zu diesem. Sich mehrmals entschuldigend, erklärte er kurz den Sachverhalt und bat um Hilfe. Der Bauer setzte sich auf seinen Traktor, fuhr zum Acker hin, befestigte an beiden Fahrzeugen ein dickes Seil und zog den Ford auf die Straße zurück. Für den angerichteten Schaden und seine Hilfeleistung verlangte er ein Fünffrankenstück, welches ihm Herr Gradwohl noch so gerne aushändigte. Die geplante Tagestour wurde daraufhin abgebrochen und sofort die Heimfahrt angetreten.
Die wunderschöne und erholsame Zeit bei der lieben Familie Gradwohl verging viel zu schnell. Nach einem Jahr hieß es für Hans Abschied nehmen und nach Wien zurückfahren. Als Hans am Bahnhof sein Zugabteil betrat, war dieses mit unzähligen Schokoladetafeln und anderen Süßigkeiten belegt. Diese hatten ihm seine Klassenkameraden, die vom Lehrer dazu animiert worden waren, hineingelegt gehabt, um dem armen Buben aus Österreich die Abreise zu versüßen.
8. Zurück ins Obdachlosenheim
Mit großer Freude wurde Hans von seiner Mutter in Wien am Westbahnhof in Empfang genommen. Von dort fuhren sie mit einem Taxi zum Obdachlosenheim. Im Heim angekommen, fühlte sich Hans augenblicklich wieder daheim, so, als wäre er nur für kurze Zeit weg gewesen. Ihm war sofort aufgefallen, dass einige Bewohner, die er kannte, weggezogen waren und neue deren Plätze eingenommen hatten. Sein Schulalltag hatte wieder begonnen, und wie zuvor besuchte er die Schule in der Kleinen Pfarrgasse. Als Hans seine Klasse betrat, bemerkte er in dieser lauter neue Gesichter. Seine Verwunderung wich rasch einer Resignation. Der Schiefertafel wegen musste er die Klasse wiederholen.
Während der Zeit, die Hans in der Schweiz zugebracht hatte, hatte seine Mutter mehr Zeit gehabt, sich umzusehen. Deshalb war es ihr gelungen, eine ständige Anstellung als Dolmetsch für Russisch in einem Bezirk über der Donau zu finden. Auch Onkel Paul fand in diesem Zeitraum eine Anstellung als Buchhalter, sein erlernter Beruf, im südlichen Teil Wiens. Mit beider Verdienst begann es ihnen wesentlich besser zu gehen.
Trotz der vielen auf Wien niedergegangenen Bomben waren in der Praterstraße noch einige intakte Kaffee- und Gasthäuser sowie zwei Kinos, in denen täglich Filme vorgeführt wurden, vorhanden. „Diana“ war der Name des größeren der beiden Kinos. Es wurde auch Lichtspieltheater genannt und befand sich, so man in Richtung Praterstern ging, auf der linken Seite der vorderen Praterstraße. Das kleinere Kino war nach Nestroy benannt. Jenes befand sich exakt linkerhand am Beginn der Tempelgasse, wenn man diese von der Praterstraße her betrat. Von den vorhandenen Gasthäusern hieß eines der besseren „Tiger“. Es stand unmittelbar neben dem völlig zerstörten Carltheater. Da es sich Gamliels nun hin und wieder leisten konnten, wurde Hans an manchen Sonn- oder Feiertagen zum „Tiger“ geschickt. Sein Auftrag war, von dort für die Familie Essen ins Heim zu bringen. Speisen, die man abholte, waren um einiges billiger als beim Besuch des Gasthauses. Zu viert hätte es ihr Budget zu sehr belastet. Mittels Aluminiummenagen, die aus bis zu fünf aufeinander stapelbaren Töpfen bestanden, ließen sich Mahlzeiten problemlos transportieren. Alle Töpfe hatten beidseitig Henkel angebracht. Durch diese schob man eine aus gleichem Material bestehende Tragehalterung, wodurch sich die aufeinandergestapelten Töpfe mit einer Hand tragen ließen. War Hans im Gasthaus angelangt, fragte er den hinter dem Tresen werkenden Wirt, ob die Speisen, die zu holen ihm seine Mutter aufgetragen hatte, zu haben seien. Nickte sein Gegenüber, übergab ihm Hans die Menagen, nannte die Anzahl der Portionen und zahlte den geforderten Betrag. Nach wenigen Minuten wurden ihm die in die Menagen gefüllten Speisen überreicht, und er machte sich umgehend auf den Heimweg. Die Mahlzeiten blieben warm, da sich der „Tiger“ vom Heim keine fünf Minuten entfernt befand. So konnte Dorothea sofort mit dem Aufteilen und alle mit dem Verspeisen beginnen.
Im Allgemeinen wurde in die Praterstraße einkaufen gegangen. Mehrere Geschäfte, welche die Kriegsereignisse unbeschadet überstanden hatten, waren von ihren Eigentümern oder neuen Inhabern wieder aktiviert worden. Zum Einkaufen und nicht nur dahin wurde immer Hans geschickt, außer seine Mutter hatte besondere Gründe, dies selbst zu tun. Das Warenangebot beschränkte sich anfangs im Großen und Ganzen auf die Grundnahrungsmittel. Diese konnten nur mit Lebensmittelmarken bezogen werden. Der Zuteilungsmodus zum Bezug dieser Marken richtete sich nach der vom dafür zuständigen Amt erwogenen Bedürftigkeit. Beim Einkaufen und Aussuchen von Waren war für die Allermeisten stets der Leitsatz „Entweder dies oder jenes, aber nie beides“ im Hinterkopf präsent. Reis war neben Kartoffeln nicht nur bei Gamliels das Hauptnahrungsmittel. Reis öfters als Kartoffeln. Die Qualität der einigermaßen günstig angebotenen Kartoffeln war dermaßen schlecht, weshalb bei ihnen mehr Reis konsumiert wurde. Beim Schälen von Kartoffeln ärgerte sich Dorothea oft maßlos, weil sie zu viel Ungenießbares wegschneiden musste. Auch die Reisqualität, die sie sich leisten mochten, war nicht hochwertig. Beabsichtigte Dorothea, Risipisi [41] herzustellen, was sehr oft vorkam, beauftragte sie Hans, jene Menge Reis, die sie dazu benötigte, auf ein flaches Blech oder ein Stück größeres, weißes Papier zu schütten. Auf diese Weise war es für ihn leichter, den Reis von allen vorhandenen Fremdkörpern wie kleinen Steinchen oder Holzstücken und anderen Verunreinigungen zu säubern. Es kam einiges zusammen, was das gekaufte Reisgewicht verminderte. Dies war abermals ein Grund, worüber sich seine Mutter ärgerte. Eine ähnliche Aufgabe bescherte ihm Dorothea, sobald sie frische Erbsenschoten gekauft hatte. Zur Zubereitung von Risipisi wurden solche benötigt. Hans musste dann die Erbsen aus den Schoten herauslösen. Fast jedes Mal waren viele von kleinen weißen Raupen befallen, welche bereits Erbsen angefressen hatten. Diese auszusortieren und wegzuwerfen war sein Auftrag. Dass sich Dorothea auch über diese arg dezimierte Restmenge ärgerte, war verständlich. Wollte jemand Waren, die nicht im täglichen Angebot verfügbar waren, kaufen, war dies nur mit Beziehungen oder über den verbotenen Schleichhandel möglich. Das wiederum nur dann, wenn der Kaufwillige über US-Dollar verfügte. In den Lebensmittelläden schnitt die Verkäuferin je nach Menge des gekauften Produktes einen oder mehrere nummerierte Abschnitte von der dafür nötigen Lebensmittelkarte weg. Milch wurde im Molkereigeschäft sowohl als Magermilch wie auch als Vollmilch im Offenausschank angeboten. Aus großen Milchkannen wurde diese in mitgebrachte Glasflaschen oder Töpfe mittels geeichter Messbecher eingefüllt. Butter, Germ und Käse wurden folgendermaßen verkauft: Man nannte das gewünschte Gewicht, welches von der in größeren Blocks angelieferten Ware abgeschnitten wurde. Die Portion wurde in eine Waagschale gelegt und so lange auf der Gegenseite mit Metallgewichten austariert, bis das vom Kunden gewünschte Gewicht erreicht war. In den allermeisten Lebensmittelgeschäften beschränkte sich das Warenangebot lange darauf, nur das Lebensnotwendige anzubieten. Ausgenommen bei „Julius Meinl“, der in seiner Feinkost-Ladenkette fast alles an Erlesenem feilbot. Die Nachfrage nach mehr hielt sich, des nicht vorhandenen Geldes wegen, noch längere Zeit in Grenzen. Für Hans lief das Einkaufen immer gleich ab. Am frühen Morgen wurde er zum Milchgeschäft geschickt, welches bei seinem Eintreffen oft noch geschlossen war. Das Milchgeschäft befand sich von der Tempelgasse kommend auf der gegenüberliegenden Seite der Praterstraße, nicht unweit vom Gasthaus „Tiger“. Geführt wurde es wie fast alle Läden von einer Frau. War er dort angelangt, schloss er sich an die bereits vor dem Laden Wartenden an und harrte mit jenen darauf, dass endlich geöffnet werde. Ärgerlich war es nicht nur für ihn, wenn er sich vergebens angestellt hatte. Dies war dann der Fall, wenn dem Geschäft zu wenige Waren zugeteilt wurden oder zu viele Kaufwillige anstanden. Dann fluchten und schimpften einige der Erwachsenen lauthals. Jeder davon Betroffene nahm sich hernach insgeheim vor, beim nächsten Einkauf noch eher zu erscheinen. Manche stießen gar Drohungen aus, die besagten, in Zukunft hierher nicht mehr einkaufen zu kommen. Nicht selten hatte Hans deshalb versucht, zuerst die Anzahl der vor ihm in der Warteschlange Stehenden auszumachen. Hatte er diese durchgezählt, verglich er die Zahl mit den in der Verkaufsstellage vorhandenen Brotlaiben. War die Anzahl der Brote geringer, betete er insgeheim darum, dass nicht alle vor ihm Stehenden Brot zu kaufen beabsichtigten. Bis er endlich dran war, hatte er ein Wechselbad an Gefühlen zu durchleiden gehabt.
In die Ferdinandstraße ging man der wenig vorhandenen Läden wegen kaum einkaufen. An einer Ecke, an welcher sie sich mit der Tempelgasse kreuzt, existierte eine Bäckerei. Als Heimbewohner mit Familie tat man gut daran, gerade jene Bäckerei hin und wieder bei Einkäufen aus folgendem Grund zu berücksichtigen. Viele im Heim hausende Frauen mit Mann und/oder Kindern waren es aus Vorkriegszeiten nicht nur zu kochen, sondern liebend gerne auch selbst zu backen gewohnt. Die Gegebenheiten im Heim waren dafür nicht vorhanden. Der Drang, selbst zu backen, steigerte sich besonders bei den aus Osteuropa stammenden Heimbewohnerinnen enorm, sobald das Angebot in den Läden mit Backzutaten wie Vanillinzucker, Backpulver usw. bereichert wurde. Alleine deshalb war es von großem Vorteil, vom Bäcker oder dessen Frau als Kunde identifiziert zu werden. Bald schon ersuchte eine Heimbewohnerin nach der anderen, die als Kundinnen bekannt waren, den Bäcker darum, einen von ihnen gefertigten Teig, den man auf einem Backblech in die Bäckerei bringen werde, im Ofen freundlicherweise mitzubacken. Er willigte nur mürrisch ein, und das, obschon er für diese Gefälligkeit einen Obolus verlangte. Brachte man das Blech mit der geformten Teigware zu ihm, nannte er eine Zeit, zu welcher man das Backwerk abholen konnte. Man konnte darauf wetten, dass hernach am Gebackenen eine Seite ziemlich angebrannt war. Dies musste, wollte man den Bäcker weitere Male damit behelligen, in Kauf genommen werden. Dorothea war ebenfalls dazu übergegangen, Kuchen selber zu fertigen. Hatte sie einen Kuchenteig fertig gerührt, durfte diesen Hans in die Bäckerei bringen und auch abholen. Regelmäßig schimpfte Dorothea den Bäcker aus, sobald Hans mit ihrem Kuchen im Heim eintraf. Wie jene der anderen Frauen war auch ihr Kuchen auf einer Seite stark angebrannt. Der Schein schien nicht zu trügen, dass der Bäcker aus Ärger darüber, weil man Kuchen und dergleichen nicht bei ihm kaufte, die zu ihm gebrachte Ware absichtlich anbrennen ließ.
Schräg gegenüber der Bäckerei, in der Ferdinandstraße, befand sich ein Laden. Über dessen Eingang prangte ein großes Schild, auf welchem „Kolonialwaren“ geschrieben stand. Überdies waren links und rechts an dessen Eingang ziemlich große, emaillierte Reklametafeln angebracht. Auf diesen standen viele Namen der Waren aufgelistet, die man einst regelmäßig, jetzt aber, der misslichen Lage wegen, kaum oder gar nicht kaufen konnte. Trat man in den Laden, dessen Inneres auch bei Tageslicht dunkel und düster war, umhüllte einen sofort ein süßlicher, gewürzschwerer Mischmaschgeruch. Reis, Grieß und verschiedene getrocknete Hülsenfrüchte wurden aus auf dem Boden stehenden Jutesäcken, aber auch aus anderen Behältnissen dargeboten. Diese Waren wurden von der Betreiberin des Laden, einer älteren, jetzt oder immer schon allein stehenden Frau mittels einer Tasse herausgeschöpft und in eine Blechwanne, die auf einer alten Dezimalwaage auflag, geschüttet. In die Tarierwanne auf der Gegenseite legte sie so lange Messing- oder Eisengewichte, bis sich die beiden Zeiger deckten und damit das gewünschte Gewicht anzeigten. Das Aussehen der älteren Frau kam jener herrlichen, von Wilhelm Busch kreierten „Witwe Bolte“ sehr nahe. War das exakte Austarieren für die doch schon ältere Ladenbetreiberin zu sehr zeitaufwendig, versuchte sie dies häufig mit der Frage „Ob’s ein bisserl mehr sein dürfe?“ zu verkürzen. Meistens wurde mit Kopfnicken zugestimmt. In selbst gerollte Papiertüten, sie hatte diese aus nicht mehr aktuellem Zeitungspapier zusammengeschnitten, füllte sie die Ware. Je nachdem, in welchem Teil des Ladens man sich befand, roch es auch nach Petroleum, Schmierseife und Undefinierbarem. Hans wurde dann zu diesem Laden geschickt, wenn Dorothea den Fußboden des Zimmers aufzuwaschen im Sinne hatte. Dazu verwendete sie sowohl Sodakristalle wie auch die Kernseife der Marke „Hirsch“. Petroleum für den kleinen Ofen wurde ebenfalls aus diesem Laden bezogen. Nahe vom Eissalon in der Praterstraße, den ein italienisches Ehepaar führte, befand sich eine Drogerie. Benötigte Onkel Paul Nachschub an Rasierklingen, wurde Hans diese zu besorgen losgeschickt. Es musste die Marke „Rotbart“ sein. Auch die Seife der Marke „Elida“ – es kam bei ihnen nur diese für die Körperpflege zur Anwendung – und das von Dorothea so geliebte Kölnischwasser „4711“ wurden dort eingekauft.
Julius Meinl, der Name der bekanntesten alteingesessenen Wiener Delikatessenfirma, war mit einem Laden in der Praterstraße präsent. Er wurde von Herrn Pirezky und einigen Mitarbeitern geführt. Bis Ende der Vierzigerjahre war das Einkaufen in diesem Laden nur jenen vorbehalten, die genügend Geld besaßen. Sehr selten, aber hin und wieder doch, ging auch Dorothea dorthin einkaufen oder schickte Hans dahin. Bei Meinl war alles frischer, exklusiver und schöner, jedoch wesentlich teurer als in anderen Läden. So klein dieser Laden war, schien er sowohl vom Warenangebot und der Auswahl, wie sonderbarerweise auch von Kaufwilligen, oftmals überfüllt. Stets war bestens geschultes, freundliches und genügend Personal zugegen. Vom in firmeneigene, hellbraune Uniformmäntel gekleideten Personal wurde jeder Kunde zuvorkommend bedient. Bei Meinl als Verkäufer oder Lehrling engagiert zu werden, waren viele Arbeit Suchende wie auch Schulabgänger bestrebt. Es hatten nur jene Bewerber eine Chance, die einen erstklassigen Schulabschluss vorweisen konnten sowie eine betriebsinterne Prüfung bestanden. Selbst danach wurde unter den Bewerbern nochmals ausgesiebt. Hatte jemand die Zusage der so sehr umworbenen Anstellung bekommen, konnte er oder sie sich fast „von“ nennen. Das Personal von Meinl stand im beruflichen Ansehen weit über anderem Verkaufspersonal, was sich auch im besseren Verdienst bemerkbar machte.
Mit großer Treffsicherheit ließen dreißig bis fünfzig Prozent der Heimbewohner beim Einkaufen anschreiben. Das hieß schlicht und einfach, nicht alles Eingekaufte zahlen zu können und den Rest anschreiben zu lassen. Machbar war dies jedoch nur dann, wenn man dem Ladenbetreiber einigermaßen bekannt war. Sobald man knapp bei Kassa war, demnach sehr oft, wurde so verfahren. Auf diese Weise wurstelten sich viele von einem zum anderen Monat hinüber. Usus war, jene Geschäfte zu umgehen, bei denen man längere Zeit mit der Bezahlung seiner Schulden in Rückstand geraten war. Gelang es jemandem nicht, vorrangige Schulden zeitgerecht zu begleichen, wurde ein Pfändungsbeamter mit dem Schuldeneintreiben beauftragt. Manch einer geriet dadurch in einen Kreislauf von Schulden machen und nicht wie abgemacht bezahlen können, aus welchem auszubrechen erst Jahre später gelang.
Neben Tee, selten Kaffee und wenn, so dem „Franck-Aroma-Feigenkaffe“, oder dem herrlichen Wiener Hochquellenwasser trank man bei Gamliels sehr gerne Letztgenanntes, zwischendurch auch mal mit Himbeersirup gesüßt. Besonders fein und vor allem prickelnd schmeckte der Sirup, spritzte man ihn mit Sodawasser auf. Sodawasser wurde in der Fabrik in dicke Glasflaschen abgefüllt und war nur über Gasthäuser im Gassenverkauf erhältlich. Die Flaschen standen unter starkem Kohlensäuredruck und waren deshalb mit einem speziellen Metallverschluss, einem ebensolchen Auslass und Hebel versehen. Wollte Dorothea den Kindern Freude bereiten oder wenn es sie selbst danach gelüstete, wurde Hans in ein nächstgelegenes Gasthaus eine solche Flasche holen geschickt. Ehe ihm der Gastwirt die Flasche über die Schank hinweg reichte, lief immer der gleiche Vorgang ab. Er verabsäumte es nie, sich zu vergewissern, dass der Flascheninhalt unter genügend starkem Druck stehe. Dies stellte er fest, indem er mit kurzem, sehr schnell ausgeführtem Schlag auf den Hebel schlug. Das lief dermaßen schnell ab, dass im selben Moment ein kurzer Wasserstrahl von der von ihm ins Spülbecken geneigten Flasche dort hineinschoss. Erst danach überreichte er sie Hans. Nun ergab sich, dass Hans wieder einmal eine Siphonflasche zu holen geschickt wurde. Diesmal herrschte im Gasthaus ein unheimlicher Stoßbetrieb. Das Servierpersonal schwirrte umher. Auch der Gastwirt stand unruhig und arg schwitzend hinter dem Schanktisch. Des turbulenten Geschäftsganges wegen überreichte der Wirt diesmal Hans die Flasche, ohne den Probeschlag ausgeführt zu haben. Bewusst unterließ es Hans, ihn auf dessen Versäumnis aufmerksam zu machen. Insgeheim hatte Hans schon längst darauf gewartet, dass dieser Fall eintreten möge. Deshalb verließ Hans rascher als sonst das Lokal. Sowie er draußen war, hatte Hans im Sinne, die Kontrolle an der Flasche nachzuholen und danach die Praterstraße zu überqueren. Hans stand bereits an der Gehsteigkante. Er konzentrierte sich wesentlich mehr auf die Ausführung seines Vorhabens als auf den Verkehr auf der Hauptstraße. Die Routine, mit welcher der Wirt diese Tätigkeit ausführte, war für Hans nicht nachvollziehbar. Einerseits kämpfte er mit dem beachtlichen Gewicht der Flasche, andererseits damit, diese mit einer Hand so zu halten, um endlich mit der anderen den Kontrollschlag ausführen zu können. Die Wegstrecke vom Gasthaus zum Heim war kurz. Er geriet in Zeitnot. Diese Tätigkeit wollte er unbedingt noch hinter sich bringen. Endlich meinte er, alles im Griff zu haben. Er schlug auf den Hebel und fühlte sich danach für einen kurzen Augenblick mächtig. Es funktionierte ebenso, als ob es der Wirt selbst getan hätte. Doch aus der Siphonflasche schoss ein wesentlich längerer Strahl als sonst beim Wirt hinaus. Offensichtlich hatte Hans den Hebel zu lange gedrückt gehabt und den Ausfluss der Flasche nicht wie der Wirt nach unten geneigt gehalten. Deshalb schoss der Strahl gegen die Straßenmitte hin. Dieser lange hinausschießende Wasserstrahl traf einen just im selben Augenblick mit einer Beiwagenmaschine vorbeifahrenden Motorradfahrer mitten ins Gesicht. Wie vom Blitz getroffen erschrak der Mann. Vom Verlassen des Strahls aus der Flasche bis hin zum erschreckten Antlitz des Motorradfahrers hatte Hans alles verfolgt. Als er das Malheur erkannte, war auch er wie vom Blitz getroffen. Einen Augenblick lang stand er erstarrt da, um im Moment darauf, nachdem sein Hirn den Befehl an seine Beine, rasch davonzulaufen, abgesandt hatte, diesem Befehl nachzukommen. Derweil verriss der Mann seine Maschine derart stark, dass er eine Strecke in Schlangenlinien fuhr. Als er sein Gefährt wieder unter Kontrolle gebracht hatte, wendete er mit diesem und machte sich daran, dem nicht weniger erschrockenen, nun eilig davonlaufenden Knaben nachzufahren. Sowohl der erschreckte Motorradfahrer wie auch Hans hatten großes Glück. Der Motorradfahrer, weil er mit seinem Gefährt nicht in einen der damals auf der Straße stehenden Kandelaber hineinkrachte, und Hans, weil dem Mann nichts geschehen war und er von ihm nicht erwischt wurde. Aufs heftigste keuchend, erreichte er das rettende Zimmer im Heim. Seiner über ihn staunenden Mutter die Flasche in die Hände drückend, versuchte er, mit unverständlichen Wortfetzen eine Erklärung für sein Hasten zu übermitteln. Zugleich zwängte er sich in den Kasten, um sich in diesem zu verstecken. Der Motorradfahrer hatte wohl gesehen, wohin Hans gelaufen und in welchem Haus er verschwunden war. Er fuhr durch das offen stehende Tor in den Hof ein. Durch das geöffnete Fenster vernahm Dorothea eine brüllende Männerstimme. Sie lehnte sich zum Fenster hinaus, blickte hinab. Obgleich sie noch nicht wusste, worum es ging, versuchte sie, den zu Recht aufgebrachten Mann zu besänftigen. Nach einigem Hin-und-her-Geplänkel wendete er sich ab, startete die Maschine, setzte das Vehikel in Bewegung und fuhr mit heftigem Kopfschütteln davon. Erst nach einer Weile wagte Hans, sein Versteck zu verlassen und genauer über das eben Geschehene zu berichten. Dabei war er fest davon überzeugt, nichts dafür gekonnt zu haben. Von ihm aus gesehen war alleine der Wirt, seiner Nachlässigkeit wegen, am Vorgefallenen Schuld.
Langsam konnte man in Wien an vielen von Ruinen und Schuttbergen frei gewordenen Plätzen neue Bauten entstehen sehen. Vorrangig wurden Wohnhäuser errichtet. Die meisten wurden von der Gemeinde Wien erbaut und Gemeindebauten genannt. Die entstandenen Wohnungen wurden von der Gemeinde nach einem für Außenstehende oftmals nicht nachvollziehbaren Modus vergeben. Auf Dorotheas mehrmalige Nachfragen hieß es immer, dass Bedürftige vorrangig bedient werden. Die längste Zeit schon fasste Dorothea nach allen noch so kleinen Strohhalmen, um mit den Kindern und Onkel Paul endlich aus dem Heimzimmer in eine Gemeindewohnung ziehen zu können. Es war ihr unbegreiflich, weshalb ausgerechnet sie nicht als bedürftig erachtet wurden. Andere Heimbewohner, die nicht ausreisten, waren schon längst in den Genuss einer Gemeindewohnung gekommen. Gedanken, eine eigene Wohnung zu erstehen, waren Verschwendung, weil das dafür nötige Geld nie und nimmer vorhanden war. Immer wieder verschickte sie Eingaben über Eingaben an alle zuständigen Institutionen, an so genannte „Macher“ (so wurden jene genannt, die behaupteten, Beziehungen da- und dorthin zu haben) bis hin zum Bundeskanzler und Bundespräsidenten. Jedes Mal und immer wieder vergebens wies sie dabei auf ihre missliche Lage, Bedürftigkeit und die Länge ihres Heimaufenthaltes hin. Die Wohnungsvergabe hing, wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen, davon ab, welcher Gesinnung und Partei man zugehörig war. Da hatten Dorothea und Onkel Paul die wohl schlechtesten Karten zur Hand. Beide waren sie KPÖ-Mitglieder [42]. Wenn auch niemals offiziell bestätigt, war dies der Hauptgrund dafür, dass alle versendeten Eingaben von vornherein „für die Katz“ waren. Es war doch die Sowjetarmee, die sie vom Hitlerjoch befreit hatte – war es deshalb aus vielerlei zeitbezogenen Gründen, aus Dankbarkeit an die Retter und aus der vorherrschenden Weltanschauung heraus nicht naheliegend und verständlich, dass auch viele Juden zu den Kommunisten tendierten? Hatten nicht die Sowjets Onkel Paul, trotz zehn Jahre dauernder Emigration, noch dazu in Sibirien, sein Überleben ermöglicht? Zudem befand sich das Obdachlosenheim in der Leopoldstadt, welche nicht nur sowjetische Besatzungszone, sondern eine Hochburg der KPÖ Wien war. Daher war in den Augen Onkel Pauls und für Dorothea Genosse Stalin [43] nicht nur der Staatschef der Sowjetunion, sondern ihr Befreier. Erst Jahre später erfuhr auch die Mehrheit der Menschen, dass der nicht nur von ihnen umjubelte Georgier ihrem Peiniger Hitler um nichts an Grausamkeiten nachstand. Dann begann ein massenhaftes Umdenken.
Industriebetriebe, welche noch intakt und in der sowjetischen Zone angesiedelt waren, wurden von den Russen so rasch wie machbar aktiviert. Selbstverständlich wurden diese von russischen Direktoren geleitet. Durch diese wirtschaftliche Ankurbelung fanden viele Wiener Beschäftigungen. Selbst da wurden Leute, die Mitglieder der KPÖ waren, vorrangig eingestellt. Die KPÖ hatte deshalb regen Zulauf. In solch einem im östlichen Teil Wiens gelegenen Betrieb hatte Dorothea, die fünf Fremdsprachen in Wort und Schrift perfekt beherrschte, eine Anstellung als Chefdolmetsch und Sekretärin gefunden. Auch Onkel Paul hatte als Parteimitglied Arbeit in einem von den Sowjets geführten Betrieb gefunden. Dieser lag im südlichen Wien. Er arbeitete dort in seinem erlernten Beruf als Buchhalter. Dabei wäre er liebend gerne als Musiker tätig gewesen. Zu Hause in der Tempelgasse wurde täglich Zeitung gelesen. Entweder die „Volksstimme“, manchmal auch „Der Abend“, beides kommunistische Zeitungen. An Wochenenden wurde „Neues Österreich“, die Tageszeitung der „schwarzen Partei“, gekauft und gelesen. „Neues Österreich“ deshalb, weil in dieser die allermeisten Stellenangebote inseriert waren. Onkel Paul, der seinen Arbeitsalltag nach wie vor mit Musikmachen zu gestalten im Sinne hatte, ackerte deshalb alle Inserate durch.
Ein Parteilokal der KPÖ befand sich in der Praterstraße Nr. 24. Es wurde einige Zeit später in das Haus Nr. 54 verlegt, in jenes Haus, in welchem Johann Strauß den Donauwalzer komponiert hatte. Die neue, junge Generation wurde von der KPÖ besonders umworben. Für diese Jugendlichen, aber auch für Erwachsene wurden viele Veranstaltungen organisiert. Hin und wieder lud die KPÖ zu wunderbaren „Bunten Abenden“ ein. Durch diese führten abwechselnd bekannte Conferenciers [44] wie Max Lustig [45], Else Rambausek [46] oder Richard Eybner [47]. Nicht selten traten Ensembles der Rotarmisten [48] auf. Deren atemberaubende und zugleich artistische Tanzvorführungen waren einmalig. War der weithin bekannte Chorleiter Sergei Jaroff mit seinen Don Kosaken [49] angesagt, die herrliche, mitreißende, aber auch schwermütige, zu Herzen gehende melancholische Lieder sangen, waren die Veranstaltungssäle jeweils restlos ausverkauft. Jährlich organisierte die KPÖ Spiele, veranstaltete Feste oder Ferienlager, die von vielen – nicht nur – Genossen gerne besucht und genutzt wurden. Eine Abteilung der Jungkommunisten nannte sich „Junge Garde“. Deren Mitglieder trugen Uniformen, welche aus blauen Leinenhemden mit entsprechendem Emblem auf der Brusttasche versehen waren. Zum Hemd gehörte ein rotes Halstuch, das umgebunden und dessen zwei Enden durch einen geflochtenen Lederknopf durchgezogen werden mussten und von diesem festgehalten wurden. Am meisten bewunderte Hans den für Knaben bestimmten dazugehörigen Ledergürtel. Dieser war mit einfachem Handgriff zu handhaben. Hans faszinierte besonders dessen runder Metallverschluss, auf dem eine Lilie eingestanzt war. Um diesen Jungkommunisten anzugehören, war Hans zu jung. Viel gewichtiger gegen seine Zugehörigkeit war aber die gewaltige Abneigung seiner Mutter gegenüber allen, die Uniformen trugen, auch dann, wenn diejenigen Kommunisten waren. Nichtsdestotrotz sang Hans bei Veranstaltungen gemeinsam mit anderen Jugendlichen die klassischen Parteilieder wie „Jugend heraus aus den Häusern...“ oder „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit ...“ [50].
Fanden derlei Veranstaltungen im weitläufigen Pratergelände statt, fühlte Hans sich geehrt, wenn man ihn beauftragte, „Moretti-Eislutscher“ zu verkaufen. Damit er diese Tätigkeit ausüben konnte, wurde ihm eine innen isolierte Holzkiste mit Lederriemen umgehängt, in welcher die beliebten Eislutscher halbwegs kühl lagerten. Hans hatte Spaß am Verkauf und brachte die Kiste stets leer retour.
Zwei Jahre nach Hans wurde Erika eingeschult. Ihre Volksschule befand sich ebenfalls im zweiten Bezirk in der Kleinen Sperlgasse. Der Schulweg dahin war halb so lang wie jener zur Schule von Hans. Beide Kinder waren von ihrer Mutter unzählige Male angewiesen worden, nach Unterrichtsschluss sofort und auf kürzestem Weg nach Hause zu kommen, es sei denn, sie gingen zur Ausspeisung in die Leopoldsgasse. Im Gegensatz zu Hans hatte Erika, was das pünktliche Erscheinen daheim betraf, trotz kürzerem Schulweg immer wieder Probleme. Übermäßig lange Verspätungen waren bei ihr die Regel. Erika tat nichts anderes, als mit Schulkolleginnen am Nachhauseweg zu tratschen. Während sie tratschten, legten sie Unmengen an Gehpausen ein. Verständlicherweise bereitete Erikas Verhalten Dorothea jedes Mal Sorgen. Erika musste ihr Zuspätkommen jeweils mit Hausarrest büßen.
Hans wurde während seiner gesamten Schulzeit kein einziges Mal antisemitisch angepöbelt. Dabei wohnte er in einem typischen Wiener Proletenbezirk, zudem im Judenbezirk auf der so genannten „Mazzesinsel“ [51]. Vielleicht war es deshalb nie der Fall, weil weder er noch Erika ein jüdisches Aussehen – wenn es ein solches überhaupt gibt – hatten. Ihr Judentum war ihnen eigentlich nur dann bewusst, wenn sie sich im Heim aufhielten. Nicht jüdischen Freunden oder Fremden gegenüber verschwiegen sie grundsätzlich ihre Glaubenszugehörigkeit. Selbst der Umstand, dass sie während des christlichen Religionsunterrichtes Parallelklassen aufsuchen mussten, schürte bei keinem Mitschüler Neugier oder veranlasste diese, deshalb Fragen zu stellen.
Ausgerechnet in der Tempelgasse, wo alle Gassenbewohner von der Existenz des jüdischen Heimes Kenntnis hatten, kam es komischerweise hie und da doch vor, von in unmittelbarer Nachbarschaft wohnenden Jugendlichen als „Saujud“ beschimpft zu werden. Zur Entlastung solcher Jugendlicher muss beigefügt werden, dass sie dies nur dann taten, wenn sie mit Knaben aus dem Heim Fußball spielten und die Judenbuben als Sieger feststanden. Im Heim wohnten nie mehr als maximal vier Knaben zur selben Zeit. Erwachsene hielten sich mit dem Gebrauch des erwähnten Schimpfwortes eher zurück. So kurze Zeit nach Kriegsende hatten viele Bedenken und Angst, als Sympathisanten der letzten Machthaber angesehen oder gar erkannt zu werden. Kamen dennoch jene oder ähnliche antisemitische Schimpfwörter über deren Lippen, konnte man in den häufigsten Fällen davon ausgehen, dass übermäßiger Alkoholkonsum der Zungenlöser war.
Mittlerweile war die Tempelruine von einer professionellen Baufirma vollends abgetragen worden. Da, wo so lange die Ruine gestanden hatte, war ein großer freier Platz entstanden. Dieser reichte vom Heim bis zur Ferdinandstraße vor und war von den Heimknaben sofort als deren Spielplatz auserkoren worden. Sobald sich die paar Heimbuben auf dem Platz zum Spielen einfanden, gesellten sich nach und nach Knaben aus Nachbarhäusern dazu. Waren auch noch so wenige beisammen, wurde sofort und immer nur Fußball gespielt. Nichts konnte die Knaben vom Fußballspielen abhalten, obschon aus dem Erdboden noch viele Ziegelbruchstücke und Steinbrocken hervorragten. Manch einer holte sich beim Stolpern über solch ein Hindernis ein blutiges Knie oder zog sich eine Verstauchung zu. Mangels eines echten, unerschwinglichen Lederfußballes verwendeten sie beim Spielen ein so genanntes „Fetzenlaberl“. Dieses war von einer den Knaben wohlgesinnten Mutter aus Stofffetzen zu einem Knäuel zusammengenäht worden. Als Ballersatz wurde es von den Knaben gerne verwendet. Den Zweck, damit ins Tor zu schießen, erfüllte es allemal. Die Torbreite wurde mit Steinen oder abgelegten Kleidungsstücken markiert und war einigermaßen erkennbar. Auseinandersetzungen gab es, wenn es einer Mannschaft um die An- oder der anderen um die Aberkennung eines Treffers ging. Sahen die einen einen knapp über den Torwart hinweg erzielten Schuss als Treffer, anerkannten die Gegenspieler diesen jedoch nicht, was eine Unterbrechung des Spieles zur Folge hatte. Ehe sich die Streiterei in die Länge zu ziehen begann, einigten sich alle mit einem Kompromiss. Die Mannschaft, die sich um den Treffer geprellt wähnte, bekam einen Penalty [52] zugesprochen. Wohin der Schuss hernach auch traf, es wurde sofort weitergespielt.
Seitdem Mutter und Onkel Paul ganztägig arbeiteten, waren sich Hans und Erika tagsüber selbst überlassen. Sie waren deshalb angehalten worden, verschiedene Hausarbeiten zu übernehmen. Dazu gehörte Betten machen, den Fußboden kehren und manchmal auch Fenster putzen. Für die Kinder war es selbstverständlich, den aufgetragenen Arbeiten, so gut sie es ihrem Alter entsprechend vermochten, Folge zu leisten. Etwa eineinhalb Jahre vor ihrem Auszug aus dem Obdachlosenheim war es Onkel Paul gelungen, einem Mitarbeiter in der Firma in Liesing, der seinen alten Ofen gegen einen neuen einzutauschen im Sinne hatte, den alten Ofen gegen einen geringen Geldbetrag abzukaufen. Alle waren überaus glücklich, als der Ofen in ihrem Zimmer an der Wand aufgestellt wurde. Hans klangen die Worte seiner Mutter in den Ohren, die nach den hinter ihr liegenden schrecklichen Jahren so oft sagte, lieber hungern als jemals wieder frieren zu wollen. Passende Rohre mussten noch gekauft werden, um den Ofen endlich anheizen zu können. Zum Einheizen wurde im unteren Teil des Ofens etwas Papier hineingestopft. Darauf kamen einige Holzscheite, und auf diese wurden einige Kohlestücke gelegt. Zuletzt wurde das Papier mit Streichhölzern angezündet. Sobald das Holz Feuer gefangen hatte, wurden einige Kohlestücke mehr darauf geschüttet. Mit dem Ofenkauf war Hans eine weitere Aufgabe zugefallen. Wann immer der Holz- oder Kohlevorrat zu Ende gegangen war und nicht genügend Geld vorhanden war, um sich solches ins Heim liefern zu lassen, wurde er in die Ferdinandstraße welches zu holen geschickt. Frau Treidl war es gelungen, in der Ferdinandstraße eine kleine leer stehende Lokalität zu mieten. In dieser unterhielt sie einen Holz- und Kohlehandel.
Hans hatte einmal bemerkt, als seine Mutter den Ofen anheizte und die Steinkohle nicht so recht Feuer fangen wollte, dass sie einen Schuss Petroleum aus einer Flasche hineingoss. Danach brannte die Kohle sofort. Immer noch war Petroleum vorhanden, weil das kleine Öfchen nach wie vor zum Erwärmen kleinerer Speisen Verwendung fand. War Dorothea nicht daheim und Hans aufgetragen worden, den Ofen einzuheizen, half auch er hin und wieder mit Petroleum nach. Dass dieses Unterfangen höchst lebensgefährlich war, daran schien Dorothea nicht gedacht zu haben. Auch daran nicht, dass Hans sie dabei beobachtet haben könnte.
9. Wahre Freunde
Seit geraumer Zeit hatte es sich ergeben, dass sich Bewohner immer kürzer im Heim aufhalten mussten und rascher auswandern oder anderweitig Unterkunft finden konnten. Meistens handelte es sich um solche, die ihr Zimmer mit anderen, ihnen völlig fremden Menschen teilen mussten. Dieser Zustand war ein steter Konfliktherd. Nun war während eines Ferienaufenthaltes von Hans ein altes Ehepaar eingezogen. Die beiden, Kahane mit Namen, waren vor dem Krieg Geschäftsleute gewesen. Aus diesem Grund bewarben sie sich erfolgreich um einen seit jeher unbenutzten, verschlossenen Raum, zu welchem zwei, drei Stufen hochführten. Er befand sich an der Ecke der Tempelgasse, ehe man den Hof vom Heim betrat. Seit Hans sich erinnern mochte, war dieser Raum von einem nach unten gezogenen, mit Vorhangschloss versehenen Rollladen verschlossen. Die beiden Kahane richteten darin einen Laden ein, in welchem sie Nähutensilien wie Zwirne, schmale Bänder, Nadeln, Knöpfe u.a.m. zum Kauf anboten. Der anfängliche Enthusiasmus und Glaube der Betagten, geschäftlich erfolgreich agieren zu können, war bald einer riesigen Enttäuschung gewichen. Dazu hatten sicher der schlechte Standort, die missliche Wirtschaftslage und die nicht vorhandene Kaufkraft beigetragen. Nach wenigen Monaten mussten sie den Laden wieder schließen. Er präsentierte sich wie zuvor mit heruntergezogenem Rollo.
Wiederum wurde ein Zimmer frei und einer wartenden Familie zugeteilt. Die Familie hieß Alten. Sie bestand aus Vater Egon, einem urechten Wiener, seiner Gattin Selda, die aus Polen stammte, und deren Söhnen Heini und Peter. Heini kam in Frankreich, Peter in der Schweiz auf die Welt. Richtig hieß Heini Jucies mit Nachnamen. Er stammte aus einer früheren Beziehung seiner Mutter, war aber von Herrn Alten als Stiefsohn angenommen worden. Außer der Heimleitung wusste dies niemand, weshalb er für alle der Heini Alten war. Ihre Flucht vor Hitler hatte sie über Frankreich, die Schweiz, Belgien und schlussendlich nach Israel geführt. Beide Knaben waren derweil ins schulpflichtige Alter gekommen und besuchten in Haifa die Schule. Das ungewohnte Klima Israels setzte ihrer Mutter Selda, die an und für sich gesundheitlich nicht auf der Höhe war, sehr zu. Da der fürchterliche Krieg sein Ende gefunden hatte, entschloss sich die Familie, via Schiff nach Neapel und von dort per Bahn nach Wien zu reisen. In Wien angekommen, fanden sie für kurze Zeit bei Bekannten Unterschlupf. Danach landeten sie, wie viele vor und nach ihnen gleichfalls, im Haus Tempelgasse Nr. 3. Als sie im Heim ankamen, sprachen sie Französisch und Jiddisch, bald jedoch, was unüberhörbar Herr Alten zu fördern schien, nur noch Wienerisch. Beide Knaben waren exzellente Fußballspieler. Heini, gleich alt wie Hans, war beim Spielen ein brillanter Techniker, Peter, Jahrgang 1944, klein von Statur, dafür von wieselflinker Schnelligkeit. Seiner Kleinheit wegen wurde er von Gegenspielern oft übersehen. Oft merkten Gegenspieler nicht einmal, dass gerade er es war, der mit dem Ball am Fuß dahinlief.
Hatten Knaben beschlossen, auf dem Tempelplatz Fußball zu spielen, wählten zwei zuvor als Kapitäne Bestimmte abwechselnd aus den Umherstehenden ihre Mitspieler aus. Dann trachtete Hans, sich so hinzustellen, dass er Heini ins Auge fallen musste und dieser ihn als seinen besten Freund in seine Mannschaft aufnahm. Regelmäßig wurde Heini, der immer bester Spieler am Platz war, als einer der Kapitäne bestimmt. Hans, der mittelmäßig Fußball spielte, wusste schon, dass Heini ihn aus freundschaftlichem Wohlwollen und nicht seines fußballerischen Könnens wegen in seine Mannschaft wählte. Nach den Spielen freute sich Hans, war es doch äußerst selten, dass nicht Heinis Mannschaft den Platz als Sieger verließ.
Was Hans beim Fußballspielen nicht fertigbrachte, gelang ihm bei den Handballspielen umso besser, besonders, wenn Völkerball gespielt wurde. Als er später das Gymnasium besuchte, wurde er, sobald Handballspiele angesetzt waren, vor Spielbeginn vom Turnprofessor mit dem Schiedsrichterposten beauftragt. Dies, weil vom Professor bemerkt worden war, dass seine Schüsse dermaßen scharf ausgeführt waren und er ehedem bereits Mitschüler, die von ihm am Kopf getroffen worden waren, somit gefährdete. Die richtige Entscheidung des Professors nahm Hans – als Schüler hatte er sich ohnehin zu fügen – innerlich nicht ganz einverstanden zur Kenntnis.
Die Freundschaft, die dicke Freundschaft zwischen Hans und Heini, begann kurios. Hans wurde von seiner Mutter regelmäßig mit den Schuhen aller Familienmitglieder, diese zu putzen, auf den Gang geschickt. Nachdem Heinis Mutter Hans einmal damit beschäftigt sah, wurde Heini von ihr aufgetragen, dasselbe zu tun. Auf dem Gang, mit der geschilderten Tätigkeit beschäftigt, begegneten sich die Knaben zum allerersten Mal. Sie grüßten einander kurz, und jeder stellte abwechselnd seinem Gegenüber, während sie die Schuhe putzten, belanglose Fragen. Woher man käme, stamme und ob man dies und jenes zu tun verstünde. Schließlich lenkte Heini das Gespräch geschickt in eine für ihn viel interessanter scheinende Richtung. Er fragte Hans, wer von ihnen beiden wohl der stärkere Junge sei. Hans zuckte die Schultern und schwieg. Um dies abzuklären, möglichst sofort abzuklären, wollte Heini wissen, ob Hans einen von ihm verabreichten Boxhieb ans Kinn aushalten würde? Nur unter Heinis Zusage, hernach denselben Versuch auch bei ihm durchführen zu dürfen, willigte Hans ein. Dann lief alles sehr rasch ab. Heini verabreichte Hans einen überhaupt nicht zaghaft ausgeführten Kinnhaken. Mit Erstaunen nahm Heini zur Kenntnis, dass sein Gegenüber nicht umfiel, ja nicht einmal schwankte. Nicht minder stark retournierte Hans an Heini einen Kinnhaken. Auch Heini wankte nicht. Hinterher war natürlich jeder mächtig stolz auf sich selbst. Von diesem Moment an waren beide zu dicken Freunden geworden und haben fortan vieles miteinander unternommen.
Heini besuchte gleichfalls die Volksschule. Zum großen Bedauern von Hans ging er nicht in dessen, sondern in eine sogar näher liegende Schule. Gegen Herrn Alten hatte Dorothea aus folgendem Grund eine Abneigung und war oftmals böse auf ihn. Wollte er, wenn er mit einem oder beiden Söhnen, aus welchem nichtigen Grund auch immer, nicht zufrieden war, diesen oder beide bestrafen, gab es für ihn nur ein Züchtigungsmittel, das Zuschlagen lautete. War er dabei in Rage geraten, achtete er keineswegs darauf, wohin und womit er auf die Knaben schlug. Auch nicht darauf, dass es dabei in deren Wohnung ziemlich laut zuging und dies auch außerhalb dieser vernommen wurde. Während er dem oder den Jungen hinterherlief, lachten jene laut und wichen den Schlägen geschickt aus, indem sie unter die Betten rutschten. Zum Glück der Knaben schlug Herr Alten fast immer daneben. Dies aber konnte Dorothea nicht wissen und sehen. So ein Spektakel zog sich so lange hin, bis Herr Alten sich etwas beruhigt hatte oder außer Atem kam und vom vergeblichen Nachspringen müde geworden war und die Verfolgung aufgab. Ehe die Knaben unter den Betten wieder hervorkrochen, musste er versprechen, ihnen nichts mehr antun zu wollen. Somit waren die meisten dieser Vorfälle nur viel Lärm um nichts. Heini, mit dem Hans einige harmlose Abenteuer bestritt, ist, nachdem er bereits verheiratet und Vater von zwei Söhnen geworden war, im blühenden Alter von nur sechsundvierzig Jahren verstorben. Acht schwere Kopfoperationen konnten den bösartigen Gehirntumor, von dem er befallen worden war, nicht stoppen. Zuletzt auch noch gelähmt, musste er viel zu früh dahinscheiden.
Die Streiche, welche von Hans und Heini begangen wurden, waren die von Knaben gerne ausgeübte „Glöckerlpartie“ bis hin zum – dies aber erst in späteren Jahren – Motorradfahren ohne Führerschein. Letzteres taten sie während ihres einzigen gemeinsam unternommenen Urlaubes. Diesen verbrachten sie in einer kleinen Pension bei einem Bauern in einem winzigen Nest Kärntens. Das Örtchen, welches Schiefling hieß, lag am westlichen Ufer etwas oberhalb des Wörthersees und etwa sechs Kilometer von Villach entfernt. Den unternehmungshungrigen Burschen stand jedoch nichts anderes als Frischluft und Badevergnügen zur Verfügung. Beider Interesse fokussierte sich daher einzig auf ein uraltes, arg verstaubtes DKW-Motorrad [53], welches an den Pferdestall des Bauernhofes gelehnt stand. Es gehörte dem Besitzer der kleinen Pension, der zugleich Bauer war. Hans und Heini fragten ihn, ob er ihnen die Maschine für gelegentliche Spritztouren leihen würde. Der gutmütige Mann, der annahm, dass seine beiden Gäste Führerscheinbesitzer seien, stimmte bedenkenlos zu. In den vierzehn Tagen ihres Aufenthaltes fuhren Hans und Heini so oft in der näheren Umgebung umher, bis der Tank leer gefahren war.
Die „Glöckerlpartie“ ging folgendermaßen vonstatten: Gemeinsam durchstreiften sie einige ruhig gelegene Gassen. Hin und wieder drückten sie beim Vorbeigehen auf die neben den Haustoren angebrachten Klingelknöpfe. Jene Hausbewohner die durch das Klingeln in ihren Wohnungen aufgerufen waren, hielten, sich aus ihren Fenstern lehnend, nach vermeintlichem Besuch Ausschau. Da aber Hans und Heini nach dem Betätigen der Klingeln sofort weiterliefen, wenn möglich um eine Ecke verschwanden, konnten sie nicht gesehen werden. Diejenigen, die nach unten sahen, ärgerten sich und schlossen fluchend die Fenster wieder zu. Noch verärgerter waren Hausbewohner, deren Fenster in den Innenhof gerichtet waren. Nachdem ihre Klingeln betätigt wurden, mussten sie nach unten zum Haustor nachsehen kommen, um zu erkennen, dass sie einem Lausbubenstreich aufgesessen waren.
Als mittellose Heimkinder hatte keines von ihnen irgendwelches Spielzeug zur Verfügung. Darüber wurde nie gejammert. Diese Tatsache regte vermehrt aller Kinder Fantasie an. Sie erdachten verschiedenste Variationen von Fangenspielen, Versteckspielen, Tempelhüpfen oder spielten mit Steinen, die weit oder gezielt geworfen werden mussten. Für Heini und Hans bestand ein weiteres Zeitvertreiben darin, rascher als der andere Markennamen von sich ihnen nähernden Autos zu erkennen. Herrschte schlechtes Wetter, dann hörten sie sich in ihren Zimmern die aus dem Radio ertönenden Schlagermelodien an. Hans hatten es die Kompositionen, deren Texte und Melodien man sich merken konnte und von Interpreten wie Erni Bieler [54], Rudi Hofstetter [55], Gretl Schörg [56], Emmerich Arleth [57], Franz(l) Schier [58], Ernst Arnold [59], Maria Andergast [60] mit Hans Lang [61] und noch vielen weiteren damaligen Lieblingen dargebracht wurden, besonders angetan. Eine seiner Lieblingssendungen, die jeden Vormittag lief, hieß „Vergnügt um elf“ [62]. Da wurde eine Stunde lang Schlager gespielt und gesungen und Hans dabei sehr wohl zumute. Dann erledigte er Arbeiten, die ihm von seiner Mutter aufgetragen wurden, mit noch mehr Elan als sonst. Das Radio, welches sie besaßen, war ein kleiner schwarzer Bakelitkasten [63], ein so genannter Volksempfänger. Es war ein Produkt aus der Nazizeit. In der Mitte der unteren Frontseite war deutlich der Reichsadler mit Hakenkreuz sichtbar und links wie auch rechts ein kleiner Drehknopf vorhanden. Jenen an der linken Seite betätigte man zum Ein- und Ausschalten, den rechtsseitigen zum Einstellen der Lautstärke. Zwischen den beiden Drehknöpfen, etwas unterhalb in der Mitte, befand sich eine Drehscheibe mit weißer Skalaeinteilung und ebensolchen Ziffern. Diese musste man zur Sendersuche betätigen. Sobald Fußball-Länderspielübertragungen angesagt waren, hingen Hans und Onkel Paul mit ihren Ohren ganz nahe am Apparat. Österreichs Fußballer waren bei vielen Begegnungen die Favoriten. Gerne lauschten sie aber auch deshalb Sportübertragungen, weil der Sportreporter Heribert Meisel [64] die Übermittlungskunst derart gut beherrschte. Dessen gekonnte Schilderungen vermochten sie sich als Hörer plastisch vorzustellen, so, als befänden sie sich als Zuseher am Sportplatz. Ein Hörspiel mit sehr vielen Fortsetzungen wurde am frühen Abend jedes Wochenende gesendet. Es hieß „Die Radiofamilie“ [65]. Die Mitwirkenden waren Lieblinge der Hörer. Nicht nur bei Gamliels wurde darauf geachtet, nur ja keine der unterhaltsamen Folgen zu versäumen.
Unter der Woche immer zur selben Zeit am Nachmittag wurde die Sendung „Ein Gruß an Dich“ [66] ausgestrahlt. Während dieser Sendung wurden über die Ätherwellen Geburtstags- sowie Namenstagsgrüße und zu vielen anderen Anlässen Glückwünsche gesendet. Von vielen Hörern, denen die Sendung weniger zusagte, wurde sie deshalb „Erbschleichersendung“ genannt. Hans hörte gerne und oft Radio. Er wunderte sich, und das über Jahre hinweg, dass nach Bekanntgabe der gezogenen Lotteriezahlen der Sprecher oder die Sprecherin jedes Mal die Schlussworte „ohne Gewähr“ folgen ließ. Er begriff nicht, was „ohne Gewähr“ zu bedeuten hatte, wo er doch die Worte stets als „ohne Gewehr“ aufnahm. Hans musste noch lange mit dem „Gewehr“ im Kopfe belastet durchs Leben gehen, ehe es ihm endlich einmal in den Sinn kam, jemanden um Aufklärung seines Unverständnisses zu fragen. An die allmorgendlichen Frühnachrichten schlossen sich täglich, und dies noch einige Jahre lang, die Durchsage der Handelspreise von Agrarprodukten und jene von Schlachtvieh an. Anschließend, und zwar nahtlos, wurden Suchmeldungen nach vermissten Soldaten und Zivilpersonen jeglichen Alters und Geschlechts vom Roten Kreuz durchgesagt.
Einmal hatte Heini von jemandem, dem er behilflich gewesen war, als Dank ein paar Groschen bekommen. Erfolgreich animierte er Hans, mit ihm mitzugehen und den Wiener Wurstelprater zu durchstreifen. Um zu Fuß zum sich hinter dem Praterstern befindlichen Riesenrad zu gelangen, benötigten sie knappe fünfzehn Minuten. Von diesem weg schlenderten sie an Ringelspielen, Geister- und Hochschaubahnen und vielen weiteren Buden vorbei. Vor fast jedem Unternehmen stand ein stimmgewaltiger Ausrufer, der die Vorbeischreitenden mit mehr oder weniger originellen, manchmal auch gereimten Sprüchen zum Mitfahren oder Mitmachen zu überreden versuchte. All dies sogen Hans und Heini mit großem Gefallen auf, malten sich aus, wie lustig es wäre, da und dort mitzumachen. Vor einer Schießbude blieben sie länger staunend stehen. Diese hatte ihr besonderes Interesse entfacht. Da waren an der ihnen gegenüberliegenden Wandseite Unmengen von flachen Metallfiguren installiert. Diese stellten verschiedene Berufsgruppen, auch Märchenfiguren, allesamt bunt bemalt, dar. Auf manchen Figuren war obendrein ein weißer Kreis mit schwarzem Mittelpunkt aufgemalt. Diesen Punkt galt es mit einem Luftdruckgewehr anzuvisieren, dabei das Gewehr ruhig in den Händen zu halten und zu treffen. Traf die Bleikugel den Punkt, begann unmittelbar danach ein nicht sichtbarer, hinter der Figur angebrachter Mechanismus, der durch den Aufpralldruck aktiviert wurde, die Figur etwa fünfzehn Sekunden lang in ihren spezifischen Bewegungsablauf zu setzen. Danach stand sie wieder so lange still, bis sie neuerlich jemand aufs Korn nahm und traf. Wie gefesselt standen Hans und Heini vor dieser Bude. Nach einer Weile betrachtete Heini das bisschen Geld, das er bei sich hatte, und meinte, dass der Betrag reichen würde, um jedem von ihnen drei Schuss abgeben zu lassen. Auch jetzt war Hans einverstanden und freute sich über die selbstlose Großzügigkeit seines Freundes. Schon hatte Heini zwei Gewehre geordert, die ihnen von einer Budenhilfe umgehend, bereits geladen, somit schussbereit, übergeben wurden. Beide Knaben waren erpicht, die ihnen zur Verfügung stehenden drei Schuss so rasch wie möglich abzugeben und womöglich als Erster zu treffen. Fast zeitgleich trafen sie ihre anvisierten Ziele, und diese begannen sich augenblicklich zu bewegen. Sie fanden es sehr lustig. Sowie sie ihre Schüsse abgegeben hatten, drückten sie automatisch nochmals den Abzug ihres Gewehres durch. Sie staunten, weil es knallte und beide abermals getroffen hatten. Auch die Figuren bewegten sich erneut. Diesmal wurden diese von ihnen kaum beachtet. Ohne ein Wort zu wechseln, sahen sich Hans und Heini erstaunt an. Sie waren sich sicher, dass sich der Budengehilfe zu ihren Gunsten geirrt habe. Immer noch stumm bleibend, waren sie sich einig, weitere Schüsse abzugeben. Als sie ihre Magazine leer geschossen hatten, die Gewehre ablegten und im Begriff waren, bummelnd weiterzuziehen, baute sich urplötzlich der Budenbetreiber höchstpersönlich in voller Größe und Breite vor beiden Knaben auf. Dadurch hinderte er sie am Weggehen. Er forderte das Geld für die zu viel abgegebenen Schüsse. Im Nu wurde ihre euphorische Stimmung von einem in ihre Glieder fahrenden, lähmenden Schreck abgelöst. Ihre Köpfe waren knallrot angelaufen. Was, dachten beide, war nun zu tun? Der neuerlichen, diesmal wesentlich schrofferen, zudem mit drohendem Unterton dargebrachten Aufforderung, die Schuld augenblicklich zu begleichen, konnten sie beim besten Willen nicht nachkommen. Kleinlaut gestanden sie, kein weiteres Geld zu haben. Mit dem Geständnis gab sich der Budenbesitzer keineswegs zufrieden. Da der Betrieb weiterlief, forderte er kurzerhand Heini, der einen wunderschönen Norwegerpullover anhatte, auf, diesen auszuziehen und als Pfand zurückzulassen. Keine Alternative zur Hand habend, kam er der Aufforderung nach. Hans wie auch Heini waren über diese Lösung froh. Ihnen wurde doch gedroht, ansonsten der Polizei übergeben zu werden. Zuletzt wurde vom Koloss, dem Budenbesitzer, noch festgehalten, dass der ausstehende Betrag am darauffolgenden Tag gebracht werden müsse. Mit hängenden Köpfen trotteten sie schweigend, diesmal wesentlich langsamer und länger, als sie für den Herweg gebraucht hatten, dem Heim zu. Hans fühlte großes Unbehagen. Er dachte an seinen Freund, welcher daheim noch ein Geständnis mit fraglichen Folgen ablegen musste. Heini berichtete seiner Mutter vom Vorgefallenen und musste sich zum Glück nur Schelte anhören. Er bekam den ausstehenden Betrag, um den Pullover auslösen zu können. Am folgenden Tag erledigte er die Angelegenheit alleine. Schon bald danach dachte keiner von ihnen mehr an diesen Ort der für sie so unrühmlichen Begebenheit zurück. Sie sannen vielmehr nach neuen Abenteuern.
Hans weihte Heini in viele, lange vor des Freundes Einzug ins Heim von ihm entdeckte und bislang bestens gehütete Geheimnisse ein. Dies waren der unversperrte Dachboden oder die dunklen, muffig und erdig riechenden Kellerabteile mit den ausgelegten Rattenködern. Oft schlichen sie gemeinsam auf den Dachboden, um im Hof spielende Kinder zu beobachten, auch der weiten Aussicht wegen, die sich ihnen aus den Dachluken bot. Heini hatte einmal folgende Idee: Er brachte Papiertüten, die aus etwas dickerem Material als die üblichen gefertigt waren, mit auf den Dachboden. Er füllte einen Sack halbvoll mit Wasser, das er einen Halbstock tiefer von der Bassena holen musste, und forderte Hans auf, dasselbe zu tun. Wieder auf dem Dachboden angekommen, ließen sie die gefüllten Papiersäcke aus Dachluken knapp vor die im Hofe Spielenden plumpsen. Für Hans und Heini war dies ein riesengroßer Spaß. Nicht nur, weil jene unten durch das Platzen der aufprallenden Säcke erschraken, sondern auch, weil die Kinder unten vom in alle Richtungen spritzenden Wasser nass wurden. Beide Knaben verloren bei ihrem Tun keinen Gedanken darüber, was geschehen wäre, hätte ein hinabgeworfener Papiersack eines der Kinder am Kopf getroffen. Zu ihrem großen Glück war dies nicht geschehen.
Ein Geheimnis, es war das allergrößte, das Hans in den Jahren seines Heimleben entdeckt und bislang keinem anderen seiner früheren, kurzzeitig im Heim lebenden Spielgefährten preisgegeben hatte, verriet er nun Heini. Der war doch mittlerweile zu seinem besten Freund avanciert. Bei diesem Geheimnis handelte es sich um einen kleinen schwarzen, aus Bakelit gefertigten Schaltkasten. Dieser befand sich in Kopfhöhe im ersten Stock hinter einem Flügel der immer offen stehenden Gangtüren an der Wand. Da diese Türflügel immer offen standen, blieb das kleine Kästchen abgedeckt und somit auch unentdeckt. Auch Hans hatte diesen Kasten nur zufällig entdeckt und ebenso zufällig aus folgender Situation dessen Funktion herausgefunden:
Es ergab sich, dass er wie oft davor mit zwei, drei Heimkindern Verstecken spielte. Wieder einmal hatte er sich hinter besagtem Türflügel versteckt gehabt. Hans verhielt sich mucksmäuschenstill, um möglichst lange unentdeckt zu bleiben. Er blieb so lange Zeit unentdeckt, dass er sich darob zu langweilen begann. Um seine Langeweile zu verkürzen, ließ er seinen Blick kreisen. Mal blickte er nach unten, dann nach oben. Dabei entdeckte er den über ihm angebrachten schwarzen Kasten. Wäre an diesem nicht ein nach oben gerichteter Hebel angebracht gewesen, hätte Hans kein Interesse gezeigt. Überall im ganzen Stockwerk wurde nach Hans gesucht, nur nicht da, wo er sich befand. Die Langeweile, die Hans immer stärker befiel, wurde größer und größer. Aus dieser heraus fasste er an den Hebel. Dieser ließ sich bewegen. Langsam zog er ihn nach unten. Sowie er dies getan hatte, verlosch zugleich das spärlich leuchtende Ganglicht. Hätte Hans nicht das urplötzlich aus verschiedenen Zimmern anschwellend ertönende Gemurmel und Fluchen vernommen, es wäre ihm nie und nimmer in den Sinn gekommen, dass er mit dem Herunterdrücken des Hebels der Auslöser des vernehmlichen Unmutes war. Sicher war er sich dessen erst, als er den Hebel wieder nach oben geschoben hatte und daraufhin das Gemurmel verstummte. Mit einem Male hatte er den Zusammenhang von Hebel, Licht und Geschimpfe erfasst. In diesem Augenblick war seine Langeweile verflogen. Sein Tun begann ihm ungeheuerlichen Spaß zu bereiten. Nicht nur, dass er froh war, noch nicht gefunden worden zu sein, nahm er sich vor, wann immer es ihm langweilig werden sollte, dieses Versteck aufzusuchen und den Hebel zu betätigen. Am lustigsten fand er sein Tun dann, wenn es draußen dunkel zu werden begann und alle Bewohner auf elektrisches Licht angewiesen waren. Deshalb war Hans mächtig stolz, sein größtes Geheimnis seinem besten Freund anzuvertrauen. Heini wusste dieses Vertrauen wiederum sehr zu schätzen. Von diesem Moment an wechselten sie sich, wann immer einem danach zumute war, bei diesem Streichspiel ab. So weit, dass auch Frau Citron als Heimleiterin von diesem Schaltkasten Kenntnis habe, dachten sie nicht. Zu oft hatte der Streich funktioniert, und ebenso oft hatten sie sich darob köstlich amüsiert. Wieder einmal war Hans nach diesem Amüsement zumute. Hinter dem Türflügel stehend, hatte er unheimliche Mühe, das aus ihm herausbrechen wollende Lachen zu unterdrücken. Ihm schien diesmal das Schimpfen besonders heftig. Deutlich vernahm er das Hin-und-her-Getrappel der in Dunkelheit gestürzten Mitbewohner, die in ihren Zimmern vermutlich nach Kerzen und Streichhölzern suchten. Nach einer ziemlichen Weile nahm Hans wahr, dass sich urplötzlich der Türflügel, der ihn verdeckt hielt, in Zeitlupentempo von ihm wegbewegte. Augenblicklich begann sich ein äußerst mulmiges Gefühl in seinem unteren Körperteil auszubreiten. Jetzt war der Flügel ganz von ihm weg. In der Dunkelheit tastete eine fremde Hand über seinem Kopf nach dem Kasten und dem Hebel und drückte diesen nach oben. Sowie das Licht wieder angegangen war, blickte das ausnehmend erstaunte Augenpaar von Frau Citron auf Hans herab, während dessen erschrockene Augen den Blick der Heimleiterin erwiderten. Ihr hatte es, was sonst nie der Fall war, die Sprache verschlagen. Sie hatte mit einem, wie oftmals zuvor, technischen Defekt gerechnet, nicht jedoch damit, den bislang im Heim besonders von den drei alten Damen als Musterknaben beliebten Hans hier und vor allem damit beschäftigt anzutreffen. Sowie sie die Situation aufgeklärt sah, untersagte sie ihm mit bösem Geschimpfe, jemals den Hebel wieder anzufassen, und befahl ihm, augenblicklich sein Zimmer aufzusuchen. Mit rotem Kopf begab er sich noch gerne dahin. Doch sobald die Luft rein war, schlich er zum Zimmer seines Freundes, um diesem vom Vorgefallenen zu berichten. Danach war beiden klar, dass für sie diese Quelle des Spaßes für alle Male versiegt war.
Herr Alten möge die subjektive Beschreibung seiner Person, auch wenn er schon lange verstorben ist, dem Schreiber dieser Zeilen, der ihn jedoch genau so sah, verzeihen. Sowohl sein Aussehen wie auch sein Gehabe glichen dem eines original Wiener Strizzis in fortgeschrittenem Alter. Strizzis nannte man jene Typen, die keiner oder kaum einer geregelten Arbeit nachgingen, sich gerne von Frauen aushalten ließen, zu jeder Tages- und Nachtzeit Kaffeehäuser, Bars und ähnliche Etablissements aufsuchten, mit Gleichgesinnten Schmähs austauschten und liebend gerne in verrauchten Hinterzimmern am liebsten mit unerfahrenen Teilnehmern um beträchtliche Geldbeträge verbotene Karten- oder Glücksspiele spielten. Die Gestalt von Herrn Alten war mittelgroß und ausnehmend hager. Ging er, so stets leicht vornüber gebeugt. Obschon auch er kein frommer Jude war, trug er immer eine leicht fleckige Pullmankappe auf seinem schütter behaarten Haupt. Komplett beschrieben war er jedoch nur, dies war sein eigentliches Markenzeichen, wenn man auch eine glimmende, filterlose, an seiner Unterlippe festzukleben scheinende, herabhängende Zigarette mit einbezog. Selbst wenn er redete, und er redete viel, fiel die Zigarette nie von seiner Lippe, und ganz, ganz selten brach die immer länger werdende Asche mal ab. Während der kälteren Jahreszeit hing häufig ein gut sichtbarer Tropfen an seiner langen, hageren Nasenspitze, der je nach Heftigkeit seiner Bewegung abriss und sich umgehend erneuerte. Es kam vor, dass, während Herr Alten in der Gemeinschaftsküche am Kochen war, so ein Nasentropfen abriss und in den Topf, in welchem er eben umrührte, fiel. Dass er kochte, war nichts Besonderes, stammte er doch von einer Hotelierfamilie ab. Sein erlernter Beruf war Kellner. Den hatte er aber nur vor und möglicherweise während seiner Emigration ausgeübt. Seit er mit seiner in der Emigration gegründeten Familie nach Wien zurückgekehrt war, ging er der Tätigkeit eines „Keilers“ nach. In Wien nannte man die Hausierer Keiler. Keiler versuchten, mitgeführte Kleinwaren von Tür zu Tür und Haus zu Haus ziehend feilzubieten. Zur Ausübung dieser Tätigkeit, die er anfangs seines Heimaufenthaltes zu Fuß und mit öffentlichem Verkehrsmittel bewältigte, besaß er ein kleines, dunkles Köfferchen, das er mit sich schleppte. Dieses war mit Schuhriemen aller Farben und Längen, mit Gummibändern, Taschentüchern, Strumpfbändern, aber auch mit pikanten Damendessous voll bepackt. Unter all diesen Waren hatte er am Kofferboden, gut verborgen und nur für besondere Kundschaft bestimmt, eine beträchtliche Auswahl pornografischer Schwarzweißfotos dabei. Auch dafür schien Kundeninteresse bestanden zu haben. Hans wusste deshalb davon, weil Heini sich bei ihm für die Schaltkasteninformation revanchierte und ihm sein größtes Geheimnis, nämlich jenes vom besonderen Kofferinhalt, anvertraute. In Abwesenheit von Herrn Alten ließ er Hans einmal in das Köfferchen hineinblicken und den ominösen Inhalt ansehen.
Herrn Altens Schaffensgebiet waren unter anderem auch Kaffeehäuser in den Randbezirken Wiens, in denen er Kunden traf und warb. Mit dieser Arbeit schien er seine Familie so recht und schlecht durchzubringen und einigermaßen Geld zu verdienen. Nach geraumer Zeit schaffte er sich ein HMW-Moped [67] an. Bestimmt kaufte er dieses auf Ratenzahlung. Mit diesem Gefährt war er wesentlich flexibler unterwegs. Auf dem vorhandenen Gepäcksträger konnte er sein Köfferchen mittransportieren.
Ob Herr Alten für die Hausierertätigkeit die nötige Bewilligung besaß, darf angezweifelt bleiben. Fest stand, dass er eine Familie zu ernähren hatte, und das bewältigte er ganz gut. Wer fragt heute noch danach, mit welchen Mitteln er es zuwege brachte? Allzu lange musste Familie Alten nicht im Heim zubringen. Sie gehörten vermutlich keiner Partei an und waren bestimmt keine Kommunisten. Ihnen wurde eine Gemeindewohnung in der Stachegasse im zwölften Bezirk zugewiesen. Hans bedauerte deren Wegziehen sehr. Ihre feste Freundschaft hielt auch danach, bis zu Heinis viel zu frühem, tragischen Ableben.
(Herrn Altens Sohn Peter, dem der Verfasser dieser Niederschrift diese zu lesen zusandte, bestätigte dem Sender, dass diesem eine perfekte Beschreibung seines Vaters gelungen sei.)
10. Intermezzi
Walter, der Sohn des Ehepaares, welches die Ziegelsteine der Tempelruine bearbeitet hatte, besuchte die Realschule in der Radetzkystraße. Dorothea hatte Walters Mutter flüchtig kennengelernt. War es anders nicht machbar, konnte sie es ab und zu einrichten, Hans als Kostgänger zum Mittagessen, natürlich gegen Bezahlung, bei Frau Treidl unterzubringen. Dadurch wusste sie Hans verköstigt und unter zeitweiliger Aufsicht. Hans und Walter waren keine ausgesprochenen Freunde. Sie kannten sich als Bewohner von Häusern derselben Gasse. Walter wohnte im Haus dem Heim genau gegenüber. Ab und zu spielten sie mit anderen Knaben auf dem leer geräumten Tempelplatz Fußball. Treidls Wohnung war eine typische kleine Zimmer-Küche-Kabinettwohnung, wobei die Küche zugleich das Vorzimmer war. Das Schlafzimmer der Eltern wurde tagsüber als Wohnraum benutzt. Die Küche, an welche sich fließend das Kabinett anschloss, war Essraum, Aufenthaltsraum und Walters Schlafzimmer in einem. Herr und Frau Treidl waren einfache Leute, die aus Erfahrenem alles daran setzten, Walter eine gute Schulausbildung zu ermöglichen. Seinetwegen verzichteten sie auf die Befriedigung jeglicher Eigenbedürfnisse. Nazis waren sie vermutlich keine, zumindest keine großen, gewesen, eher Mitläufer. Nun war es ausgerechnet Walter, der in periodischen Abständen, meistens dann, wenn sie ein Fußballspiel beendet hatten und er bei den Verlierern mitspielte, gerne das Wort „Saujud“ an Hans richtete. Wohl wissend, etwas Ungehöriges, sogar Verbotenes gesagt zu haben, suchte Walter, der sich vor dem jüngeren Hans fürchtete, sein Heil im Davonlaufen zu finden. Er suchte sein nahes Zuhause zu erreichen. Obschon Hans, was sein Judentum betraf, frei erzogen wurde, fühlte er sich durch Walter arg beleidigt. Dann fühlte Hans sich verpflichtet, Walter dafür eine Lektion erteilen zu müssen. Er hetzte diesem nach, erreichte ihn meist noch, ehe dieser in seinem Haustor oder in der Wohnung verschwinden konnte. Sowie er mit ihm auf Tuchfühlung war, versetzte er Walter einen gar nicht zimperlich ausgeführten Fußtritt auf dessen Hintern. Nach solchem Vorfall ließen sie einige Tage vorübergehen, ehe sie sich neuerlich beim Fußballspiel auf dem Tempelplatz trafen, um gegeneinander oder miteinander dem Ball nachzulaufen.
Im Nachbarhaus, neben den Treidls, wohnte mit seinen Eltern ein weiterer Junge im Alter von Hans. Der Knabe hieß Günter und war ihr einziges Kind. Äußerst selten, fast nie, spielte er mit anderen Kindern, nicht einmal Fußball. Der Vater, ein ehemaliger Fremdenlegionär, war Alkoholiker und häufig betrunken. Wenn er besoffen heimwärts torkelte und ihm ein Heimbewohner begegnete, gebrauchte er immer antisemitische Schimpfworte. Die Beschimpften wichen ihm, sobald sie ihm gewahr wurden, aus, indem sie die Gassenseite wechselten. Dies aus Gewohnheit, weil ihnen die kürzlich zu Ende gegangene Zeit noch allzu deutlich im Kopfe umherschwirrte.
Jahre später, Gamliels wohnten nicht mehr im Heim, sondern in der lang ersehnten Gemeindewohnung, las Hans in einer Tageszeitung, dass Günter, der Sohn des Alkoholikers, durch Mörderhand sein junges Leben verloren hatte. Es geschah auf dem Überschwemmungsgebiet der Donau. Günter hatte dort doch einmal mit anderen Jungen Indianer und Trapper gespielt. Unter den Knaben befand sich ein etwas älterer Bursche, der ebenfalls in der Tempelgasse wohnte. Jener hieß Robert. Er war körperlich leicht behindert, weshalb er hinkte, und anscheinend auch geistig nicht ganz auf der Höhe. Beim gemeinsamen Spielen hatte jener Günter an einen Baumstamm, den sie als Marterpfahl verwendeten, fest gefesselt und dabei erdrosselt.
Der Wiederaufbau der Stadt ging immer rasanter vor sich, so dass sich die Stadtväter auch daran machten Brücken, wie die Schweden- und die Aspernbrücke, die beide aufs Schwerste beschädigt waren, wieder instand setzen zu lassen. Das war ein Spektakel, als eine Brücke nach der anderen fertiggestellt und zur Belastungsprobe freigegeben wurde. Viele schwere, voll mit Kies beladene Lastwagen fuhren auf die Brücken, auf welchen sie einige Zeit verharren mussten. An zuvor bekannt gegebenen Tagen wurden die Brücken nacheinander feierlich für alle Verkehrsteilnehmer freigegeben. Musikkapellen spielten auf, Politiker waren anwesend und hielten Reden, ehe sie ein über das Brückenende gespanntes rot-weiß-rotes Band vor dem gänzlichen Überschreiten zerschnitten. Danach wurden die Brücken von Fußgängern gestürmt und begangen, ehe hinterher auch Pkws langsam über die neuen Brücken fuhren.
Ging man von der Leopoldstadt über die Aspernbrücke, stand am linken Ende der Brücke das markante Gebäude der Wiener Urania. Es beherbergte unter anderem einen großen, mittleren und kleinen Kinosaal. Außerdem befand sich in der von Weitem sichtbaren Dachkuppel eine Sternwarte und in einem weiteren Saal gar ein Puppenspieltheater. Für den Besuch beider Institutionen wurde täglich mehrmals über den Rundfunk geworben. Um Besucher zu ködern, wurden in den beiden kleineren Kinosälen zu frühen Nachmittagsstunden, zu vergünstigten Preisen, wunderschöne Märchen-, Zeichentrick- und Propagandafilme, nicht selten sowjetischer Herkunft, gezeigt. Solche Filme durfte sich Hans, weil die Kinokarten wie erwähnt sehr billig waren, ab und zu ansehen gehen. Zwei Filme – „Die steinerne Blume“ [68] sowie „Nasr-ed-Din-Chodscha in Buchara“ [69] – hatten bei ihm großen Eindruck hinterlassen.
Es war am der Urania gegenüberliegenden Donaukanalufer, wo Hans beim Umherstreunen eine kleine, zum Himmel schauende Menschenansammlung erblickte. Neugierig geworden, näherte er sich dieser. Wie diese ebenfalls nach oben blickend, erkannte er ein starkes Seil. Dieses war aus eines Hauses Dachluke, wo es verankert war, über den Kanal hinweg zu einem anderen Haus hinüber straff gespannt. Dort mündete es gleichfalls in eine Dachluke.
Aus dem Gerede der Umherstehenden vernahm Hans, dass ein Seiltänzer, er hieß Josef Eisemann, mit spektakulären Darbietungen auf dem Seil Geld für seiner Familie Lebensunterhalt zu verdienen suchte. Sein Vorhaben schien nicht so gut, wie er es sich vorgestellt hatte, zu laufen. Um seine Darbietungen noch interessanter und spannender zu gestalten und mehr Geld spendende Zuseher anzulocken, bot er demjenigen den hohen Betrag von 50 Schilling an, der sich in einen Schubkarren von ihm auf dem Seil entlang schieben ließe. So verlockend der in Aussicht gestellte Betrag war, getraute sich niemand, darauf einzugehen. Somit balancierte er wie zuvor solo hinüber und wieder zurück. Um das Gleichgewicht besser im Griff zu haben, benutzte der Mann eine lange Balancierstange. Nach jedem Überschreiten sammelte seine als Assistentin am Boden mitwirkende Tochter Spenden ein. Dazu ging sie, einen Hut vor sich haltend, von einem Umherstehenden zum anderen. Während der Pausen, die zwischendurch eingelegt wurden, warb ihr Vater immer wieder um einen Freiwilligen. Unter den Zusehern fand sich keiner, der den Mut aufbrachte. Um allen Gaffern seine Sicherheit auf dem Hochseil zu beweisen, beschloss er, das Angebot, das er immer wieder, jedoch vergeblich, vorbrachte, mit seiner Tochter vorzuführen. Diese setzte sich zwanglos, dabei lächelnd, in den Schubkarren, den ihr Vater langsam vor sich hinzuschieben begann. Auch am folgenden und übernächsten Tag mochte sich kein Zuseher zum Mitmachen bereiterklären. Ehe sich doch noch einer dazu entschließen mochte, stürzten Vater und Tochter auf das uraniaseitige Ufer tödlich ab. Spaziergänger können auf der dortigen Uferpromenade eine Gedenktafel für die Verunglückten entdecken. [70]
Irgendwann begann es sich im Heim herumzusprechen, dass Frau Citron, obschon die jüngste im „Dreimäderlhaus“, aber dennoch in die Jahre gekommen, in den Ruhestand zu treten gedenke und die Heimleitung abzugeben im Sinne hatte. Tatsächlich präsentierte sich eines Tages auf kurz angebundene Art und Weise ein Mann mit Namen Vogel den Heimbewohnern als ihr Nachfolger. Er war um die dreißig Jahre alt, verhielt sich auffallend unpersönlich und hochnäsig. Am Anfang seiner Tätigkeit richtete er sich im Heim ein kleines Büro ein. Da die drei alten Damen nach wie vor in ihrer großen Wohnung blieben, zog er es bald vor, sein Büro wie auch seine Wohnung auswärts zu suchen und einzurichten. Danach war er im Heim äußerst selten zugegen.
Heimbewohner, die von der Naziherrschaft durch die Sowjets befreit worden waren, tendierten häufig zu den Kommunisten und deren Ideologie. Onkel Paul war solch ein Sowjetbegeisterter. Sicherlich hatte sein zehnjähriger, mehr oder wenig freiwilliger Aufenthalt in dem Riesenreich dazu beigetragen. Sowie er auf seiner Flucht vor den Nazis die Grenze zur Sowjetunion überschritten hatte und aufgegriffen worden war, wurde er umgehend nach Sibirien transportiert, interniert und zur Arbeit in einem Kohlebergwerk eingeteilt. Durch glückliche Umstände wurde er bald von dieser unzumutbaren, für ihn völlig fremden und äußerst schweren Tätigkeit abgezogen. Mit ebenso viel Glück fand er eine Anstellung in einem Kino, und zwar als Pianist. In diesem sibirischen Kino wurden Stummfilme vorgeführt, die er auf einem Klavier begleiten musste. Diese Arbeit sowie zusätzlich erteilter Unterricht auf Klavier und Akkordeon trugen dazu bei, während seiner Emigrationsjahre am Leben zu bleiben. Erst 1948 gelang es ihm, nach Wien, in seine Heimatstadt, zurückzukehren.
Herr Hans Berkowitz, ein groß gewachsener, einst nicht unhübscher Mann, war vor seiner Emigration ein recht talentierter Operettensänger. Er bewohnte mit Onkel Paul und weiteren Männern zu Beginn ihres Heimlebens ein Zimmer im dritten Stock. Berkowitz war durch und durch ein eingefleischter Kommunist. Er verbrachte seine Emigrationsjahre in Ländern Mittelamerikas und war mit den Lehren Engels, Marx’ und Lenins [71] bestens vertraut. Er hatte eine Schwester, die mit ihrem Mann eine Wohnung im Hause, in welchem sich das Dianakino befand, bewohnte. Herr Berkowitz und Onkel Paul mochten sich der gleichen ideologischen Gesinnung wegen sehr. Auch deshalb, weil viele ihrer den Kommunismus betreffenden Diskussionen in Einstimmigkeit endeten. Als dann Onkel Paul mit Dorothea und den Kindern ein Zimmer teilte, suchte ihn Herr Berkowitz häufig zu längerem Tratsch auf. Sofern Hans bei solchem Beisammensein zugegen war, war er ein aufmerksamer Zuhörer. Herrn Berkowitz’ Erzählungen klangen oftmals äußerst abenteuerlich und ebenso oft kaum glaubwürdig. Sie waren aber alle wahr. Dies bestätigte seine langjährige, viel später dann doch noch geehelichte Lebenspartnerin Mizzi Bermann, die mit ihm die Emigrationszeiten durchlebt hatte. Hin und wieder brachte er sie zu Besuchen bei den Gamliels mit. Nebenbei bemerkt war Mizzi Bermann eine Cousine von Rudolf Bing [72], dem langjährigen Intendanten der Metropolitan Opera in New York. Frau Bermann wohnte nicht im Heim, sondern auswärts. Berkowitz’ Berichte aus deren Emigrationszeiten waren sehr oft mit viel Humor gespickt, welcher sich aus damaligen unglaublichen Stegreifsituationen ergeben hatte. Sie ließen Zuhörer kaum erahnen, wie oft sich seine Erlebnisse am Rande vom Leben zum Tod abspielten. Es war nicht einfach, seinen Schilderungen zu folgen. Häufig wechselte er sprunghaft von einer Schilderung zu einer ganz anderen, so dass es beim Zuhören oft schwer fiel, den Faden nicht ganz zu verlieren. In solchen Momenten schien er fast abwesend zu sein und sein Blick ins Leere zu gehen. Es schien nur so. Herr Berkowitz hatte längst bemerkt gehabt, dass Hans sein aufmerksamster Zuhörer war. Wenige Tage danach, als er Hans im Hausflur begegnete, fragte er ihn, ob er nicht Lust hätte, jeweils am Sonntagmorgen eine kleine, keine zwei Stunden dauernde Arbeit zu übernehmen? Dem Hans, der einverstanden war und Interesse zeigte, sagte er erst hinterher, dass es sich um das Austragen der „Volksstimme“ handle. Die „Volksstimme“ war das kommunistische Tagblatt Österreichs. Dem Jungen war es recht, und seine Mutter, der er danach davon erzählte und die zu jener Zeit noch Mitglied der KPÖ war, hatte nichts einzuwenden. Wenige Wochen danach trug Hans Sonntag für Sonntag früh am Morgen an die dreißig Exemplare der Zeitung an Abonnenten aus. Von einigen erhielt er ein Trinkgeld, welches er, nachdem er die Arbeit hinter sich hatte, bei einem Bonbongeschäft in Süßigkeiten umsetzte. Das Austragen der Zeitung geschah ehrenamtlich. Entweder hatte Herr Berkowitz aus diesem Grund den Job an Hans abgetreten, oder, weil er ein Morgenmuffel war.
Onkel Paul, der mit Leib und Seele mehr Musiker als Buchhalter war, befriedigte seine Anstellung im Industriebetrieb überhaupt nicht. Er sah sie während der ganzen Zeit als momentane Notlösung an. Die tägliche umständliche, lange Fahrerei ins südliche Wien – zuerst war es ein Betrieb der „Elin“ [73] in Möllersdorf, danach derselbe Betrieb, jedoch in Liesing – veranlassten ihn eines Tages zu kündigen. Er hatte im Sinn, den Lebensunterhalt für die Familie, die er seit geraumer Zeit hatte, als Musiker zu bestreiten. Wo immer er eine Möglichkeit, als solcher unterzukommen, zu erblicken meinte, bewarb er sich. Es war jedes Mal vergebens. Dabei beherrschte er neben Klavierspielen auch ausgezeichnet das Akkordeon. Onkel Paul konnte es nicht verstehen, dass er zehn Jahre lang sein Leben in der Sowjetunion mit Musikmachen bestreiten konnte und dasselbe in seiner Heimatstadt Wien nicht möglich sein sollte. Trotz großem Repertoire an Unterhaltungsmusik, Schlagern, Wienerliedern und Operettenmelodien, von denen er viel auswendig spielen konnte, fand er weder als Alleinunterhalter noch in einer kleinen Band ein Engagement. In seiner von Mal zu Mal größer werdenden Verzweiflung und Enttäuschung wandte er sich eines Tages an die Sowjetische Botschaft. Dieser Schritt, es war ein Verzweiflungsschritt, war von Erfolg gekrönt. Fortan unterrichtete er interessierte Botschaftsangehörige auf dem Klavier oder Akkordeon. Von da an war er glücklich und zufrieden. In der Botschaft schätzte man ihn besonders, weil er diejenigen, die bei ihm Unterricht nahmen, in ihrer Sprache unterrichten konnte. Sobald man ihn besser kennengelernt hatte, er war mit Sicherheit eine Zeitlang vom sowjetischen Geheimdienst observiert und alsbald als harmlos eingestuft worden, bat man ihn obendrein bei Sonderanlässen, die sowohl in wie auch außerhalb der Botschaft stattfanden, für die musikalische Unterhaltung zu sorgen. Nicht nur, dass er dafür sehr gut bezahlt wurde, sorgte man bestens für sein leibliches Wohl. Bei Veranstaltungen außerhalb der Botschaft durfte Onkel Paul manchmal Dorothea und die Kinder mitbringen. Bei derlei Anlässen waren sie auch eingeladen, sich am reichhaltigen Buffet zu bedienen. Fast alles, was Hans und Erika auf den langen Buffettischen an Dargebotenem erblickten, war ihnen fremd. Sie fragten ihre Mutter, ob man dies und jenes wirklich essen könne. Die Kinder zogen es vor, sich nur von dem, das sie zu kennen meinten, zu nehmen. Da nützte kein Zuspruch ihrer Mutter, auch von diesem und jenem zu probieren.
Feierten die in Wien ansässigen Sowjets Weihnachten, fand das Fest in einem riesigen Saal in der Hofburg statt. Hans und Erika waren auch daran teilzunehmen manchmal eingeladen. Das war für sie ein ganz besonderes Erlebnis. Dort waren dann neben wenigen Erwachsenen eine Unmenge Kinder anwesend. Mitten in einem riesengroßen und hohen Saal stand eine noch höher als dieser selbst scheinende Tanne, die mehr als reichlich geschmückt war. Jedem Kind wurde ein Platz an einem der vielen langen Tische zugewiesen. Auf diesen waren mit herrlichen kalten Gerichten fast überladene Teller bereitgestellt. Diese schienen nur noch darauf zu warten, endlich leer gegessen zu werden. Der Höhepunkt solchen Festes war dann erreicht, wenn „Väterchen Frost“ [74], der russische Weihnachtsmann, durch eine der vielen in den großen Saal führenden Türen gemächlich hereinzuschreiten begann. Dann hörte das Klappern der Bestecke auf, und mit einem Male wurde es mucksmäuschenstill. Alle harrten in Spannung dessen, was nun noch kommen werde. Sie ahnten wohl, dass nach dem reichlichen Essen noch Geschenke und Süßigkeiten verteilt würden. Aus vielen zuvor schon um den Baum herum bereitgestellten großen Säcken und einem Jutesack, den er hinter sich herzog, holte der Weihnachtsmann gemächlich Päckchen um Päckchen hervor. Kind für Kind durfte zu ihm vorkommen und eines in Empfang nehmen. Das war dann der Moment, in welchem der ganze Saal von unzähligen noch stärker strahlenden Augenpaaren erfüllt war. Als sich hernach alle Kinder auf ihre Heimwege begaben, war ihr Geplapper lange weithin vernehmbar.
Dorothea erzog ihre Kinder so, wie sie ihre eigene Erziehung in einer frei denkenden, assimilierten jüdischen Familie erfahren hatte. So, wie sie vor dem Krieg daheim Chanukka [75] und Weihnachten, Pessach [76] und Ostern feierten, wollte sie es mit Hans und Erika halten. Einmal, es war kurz vor Weihnachten, ergab sich Folgendes: Ob ihrer Vorfreude für ihre über alles geliebten Kinder, etwas – und war es noch so wenig – arrangieren und sie damit überraschen zu können, bedachte sie nicht, dass sie im jüdisch geprägten Obdachlosenheim wohnten. Heimlich kaufte sie eine kleine, keinen Meter große Fichte. Eine Tanne wäre zu teuer gewesen. Sie hatte diesen Baum als Weihnachtsbaum vorgesehen und nannte ihn Chanukkabaum. Bis Weihnachten waren es noch wenige Tage. Um es vor ihren Kindern versteckt zu halten, stellte sie das Bäumchen in den nicht benutzten Keller hinab. Mit der „Aufmerksamkeit“ von Herrn Breier, dem Tischler, hatte sie jedoch nicht gerechnet. Er hatte Dorothea beim Hinabtragen und Verstecken des Bäumchens beobachtet gehabt. Nachdem Dorothea wieder nach oben gegangen war, begab er sich hinab, zersägte die Fichte und ließ die Teile liegen. Die Enttäuschung und Wut Dorotheas, als sie das Bäumchen hervorholen wollte und zersägt vorfand, zu beschreiben, erübrigt sich. Die ohnehin kärglich vorhandenen Weihnachtssüßigkeiten wurden nach einer Sachverhaltserklärung der Mutter gegenüber ihren Kindern zum Fest sodann nicht vom Bäumchen, sondern direkt aus der Schachtel verzehrt.
Ein anderes Malheur passierte Dorothea einmal zu Pessach beziehungsweise Ostern. Hans wurde zur Kultusgemeinde geschickt, um von dort ein, zwei Pakete Mazzes, die man zu Pessach isst, und ebensolches Mehl zu besorgen. Davor hatte Dorothea als Überraschung einige Schokoladehasen besorgt. Um diese vor den Kindern noch versteckt zu halten, deponierte sie diese bis zum Fest im Kleiderschrank unter der Wäsche. Dabei kam es ihr nicht in den Sinn, dass sie in denselben Schrank, um der Wäsche einen angenehmen Geruch zu geben, auch einige Seifenstücke gelegt hatte. Als es nun so weit war und jeder einen kleinen Schokoladehasen bekam, verzog ein jeder bereits nach dem ersten Bissen sein Gesicht, spuckte das Abgebissene in ein Papier und lehnte weiteren Verzehr ab. Dadurch, dass die Schokolade für einige Tage unter der Wäsche gemeinsam mit der Seife gelegen hatte, hatte diese deren Geschmack angenommen. Die allgemeine Ablehnung, diese weiter zu verspeisen, war somit einleuchtend. Wieder einmal ärgerte sich Dorothea fürchterlich über ihr Missgeschick, musste sie doch jeden Schilling dreimal umdrehen, ehe sie solche Extraausgaben überhaupt anzugehen wagte.
Mit dem Älterwerden kamen Hans immer häufiger die vergangenen Jahre und deren Ablauf in den Sinn. Er begann die Menschen zu bewundern, die dermaßen viel Kraft aufbrachten, wie im Besonderen auch seine Mutter, die niemals verzweifelten und ihrem tristen Lebensalltag kein vorzeitiges Ende bereitet hatten. Unzählbar viele wurden aus einem behüteten, begüterten und sorglosen Dasein urplötzlich vom einen auf den anderen Tag auf brutalste Weise herausgerissen. Wie viele verloren alles ihnen Liebe, Materielle, mit Fleiß, Können und großer Schläue Erworbene, waren mit einem Mal Freiwild geworden und haben dennoch, ungewiss des Gelingens, einen Neuanfang in Angriff genommen? Hans stellte sich die Frage, ob er selbst diese Stärke aufgebracht hätte. Er wagte sie nicht zu beantworten. Er scheute die Antwort. Bestimmt, und da war er sich sicher, hätte er sich einer Widerstandsgruppe angeschlossen und auf Gedeihen oder Verderben gegen Nazideutschland und dessen Sympathisanten angekämpft.
All die Jahre war es weder Hans noch Erika aufgefallen, dass ihre Mutter mit ihnen nie einen Friedhof aufgesucht hatte. Erst später kam ihnen die Erleuchtung. Auf welchem Friedhof hätte ihre Mutter allen ihren dahingemordeten Familienangehörigen die Ehre erweisen sollen? An welchen Stellen hatte man sie verscharrt oder ihre Asche verstreut? Auch verstanden beide erst in reiferem Alter, was sie meinte, wenn sie sagte, dass sie alle Menschen so sehr beneide, die sich an einem Grabstein ausweinen können. Der einzige Grabstein, der existierte, ist jener ihres 1940 an der Cholera verstorbenen Bruders Gaston. Dieser befindet sich auf dem jüdischen Friedhof in Thessaloniki. Aber wie oft reist man von Wien nach Thessaloniki, um einen Friedhofbesuch abzustatten?
11. Brüder, aber welche Gegensätze
Inzwischen hatte Onkel Paul über viele Umwege in Erfahrung gebracht, wo genau sein Bruder Otto in den USA lebte. Umgehend begann er sich mit ihm auf postalischem Wege in Verbindung zu setzen und erhielt bald Antwort. Ein reger Briefwechsel der Brüder begann. Otto schrieb, dass er sich von seiner ersten Frau Anni scheiden lassen und 1940 erneut geheiratet habe. Seine neue Frau hieß mit Vornamen Elisabeth, wurde jedoch Lilly gerufen. Lilly, die ledig Aschkenasi hieß, hatte 1926 den österreichischen Geiger, Komponisten, Dirigenten und Sänger Berthold Silbiger (1887–1948), der unter seinem Künstlernamen Bert Silving bekannt und sehr berühmt geworden war, geheiratet. 1927 kam ihr Sohn, den sie Viktor nannten, zur Welt. In den dreißiger Jahren hatten sie sich scheiden lassen. Da sich die „Braune Gefahr“ [77] am Horizont anzukündigen begann, besorgte Bert Silving nicht nur für sich selbst eine Einreisebewilligung für Amerika, sondern auch für seine von ihm geschiedene Frau und seinen Sohn Viktor. Nachdem sie 1938 in die USA emigriert waren, wurde Viktor drüben nur noch Vic gerufen und sein Vorname ebenso geschrieben. Vic hatte sich entschieden, bei und mit seinem Vater leben zu wollen. Lilly ging nach dessen Entscheid eigene Wege. Bis 1945 lebten Vater und Sohn miteinander, wobei Vic seinen Vater, weil dieser oft auf Tourneen und mit häufig wechselnden Partnerinnen unterwegs war, äußerst selten zu Gesicht bekam. Lilly lernte auf ihren Wegen in New York einen in die USA emigrierten Arzt aus Wien kennen. Er hieß Dr. Otto Braun und war, als er noch in Wien lebte, beim berühmten Wiener Arzt Dr. Eiselsberg [78] Assistent. Lilly und Dr. Otto Braun verliebten sich und heirateten 1940. Otto war durch den Arztberuf und seine florierende Arztpraxis reich geworden und genoss mit seiner neuen Frau das Leben in vollen Zügen.
Bert Silving war Geiger und zu seiner Zeit nicht nur in Wien eine weitum beliebte Musikerpersönlichkeit. Häufig war er auch Gastdirigent an der ungarischen Staatsoper. In der Pionierzeit des österreichischen Rundfunks hatte er bei Radio Wien jahrelang, Vormittag wie Nachmittag, gerne gehörte, fixe Sendetermine, bei denen er mit seinem „Silving-Quartett“ aufspielte. Das Quartett bestand aus ihm sowie den Herren Hans Faltl [79], Josef Richter und Franz Horak. Es war das erste Musikensemble der RAVAG (ab 1924 Radio Verkehrs Aktiengesellschaft) [80]. Silving spielte nicht nur Geige. Er komponierte viele Wienerlieder und andere Melodien, welche er mit seiner wunderschönen Stimme und mit unverwechselbarem Sprachausdruck hin und wieder auch selbst vortrug. Mit seiner Komposition „Eines schönen Tages wird’s vorbei sein“ landete er gar den ersten Radiohit. Heute würde man „die Nummer eins der Hitparade“ dazu sagen. Dieses Lied wurde von vielen bekannten Interpreten, so auch vom unvergessenen Kammersänger Erich Kunz [81], gesungen. Dass Bert Silving eine äußerst populäre Persönlichkeit war, beweist die Tatsache, dass in Wien im 13. Bezirk eine Gasse nach ihm benannt ist. Bei einer Publikumsumfrage der damaligen Zeitschrift „Radiowelt“ landete Silving mit 2.751 Stimmen hinter dem herrlichen Wienerlieder-Sänger Ernst Arnold – dem Bruder des Schauspielers Fritz Imhoff [82] – auf dem 2. Platz.
In einem von Ottos ersten Briefen an Onkel Paul kündigte er die Absicht an, jetzt, nachdem der Krieg in Europa vorbei war, einen Europaurlaub machen zu wollen. Als Zwischenstation gedachte er, einen Abstecher nach Wien einzuplanen und dabei seinen Bruder Paul zu besuchen. Onkel Paul freute sich sehr über diese Nachricht. Auch Dorothea war auf das Kennenlernen neugierig und freute sich mit ihm auf den angesagten Besuch. Insgeheim setzte Onkel Paul große Hoffnungen auf das Wiedersehen. Einerseits hatte er den „großen“ Bruder über viele Jahre nicht gesehen und ebenso lange keinerlei Kontakt gehabt, andererseits dachte er, wenn Otto sehen würde, in welcher Situation er mit seiner Familie leben musste, dass jener ihnen irgendwie helfen würde. Nichts, gar nichts davon sollte sich für sie erfüllen und sich zum Besseren wenden. Das Gegenteil war der Fall. Aus der gehegten Hoffnung resultierte eine weitere, sein noch kurzes verbleibendes Erdendasein begleitende Enttäuschung.
Der Termin des Wiedersehens rückte näher und näher. Endlich, an einem wunderschönen heißen Sommernachmittag, Hans lehnte schon lange zum Fenster hinaus, als äußerst langsam von der Praterstraße in die schmale Tempelgasse ein eleganter, riesiger amerikanischer „Schlitten“ einbog. Der Fahrer, es war Otto Braun, fuhr so langsam in die Gasse ein, als befürchtete er, der Wagen könnte seiner Breite wegen die Hausmauern streifen. Exakt vor dem „Judenhaus“ hielt er an. Einige Anwohner der Gasse, die sich wie Hans, der jedoch mit dem Wissen über den kommenden Besuch gewappnet war, gleichfalls zum Fenster hinauslehnten und die Gasse hinabsahen, staunten nicht wenig über den dunkelfarbenen, mit amerikanischen Nummernschildern versehenen Pontiac [83]. Gerne hätte Hans vor lauter Stolz allen laut zurufen wollen, dass dieser Besuch ihnen gelte. Aus der über und über chromverzierten Limousine entstiegen Otto und Lilly Braun. Gemächlich, beim Dahinschreiten immer wieder kurz anhaltend, um das Heim und dessen Umgebung in Augenschein zu nehmen, schritten sie über den Hof zum Tor hinein und in den ersten Stock hoch. Das Wiedersehen der Brüder, sie fielen sich bereits im dunklen Gang in die Arme, ließ beiden Tränen in die Augen schießen. Sobald sie sich gefasst hatten, stellten sie einander ihre Frauen vor, und ein langes Erzählen, von allen Seiten mit vielen Fragen gespickt, begann. Hans, der sich nur kurz zur Begrüßung im Zimmer aufhielt, lief danach sofort hinunter und schlich lange Zeit um das chromblitzende Fahrzeug herum. Damit beabsichtigte er, allen neugierig auf das Auto gerichteten Blicken erkennen zu geben, dass er etwas mit diesem Besuch zu tun habe. Sowohl Otto wie auch Lilly verhielten sich Onkel Paul, Dorothea und selbst den Kindern gegenüber steif und sehr distanziert. Weder Otto noch Lilly ließen für das, was sie hier offensichtlich erkannt haben mussten, nicht die geringsten Regungen erkennen. Sie sahen, dass hier eine Familie mit vier Personen in einem einzigen Raum ohne den geringsten Komfort hauste, und übersahen dies bewusst. Sie sahen darüber hinweg, sahen es als „So ist es eben“ und als gegeben an. Unweigerlich überkam einen der Eindruck, dass Otto und Lilly sich schnell in Amerika eingelebt und die dort herrschende Mentalität in sich aufgesogen hatten. Darob vertraten sie die Ansicht, dass die einen eben Glück und die anderen Pech gehabt hätten. Mit einer solchen, keineswegs gespielten Gefühlskälte seitens seines Bruders und dessen Frau hatte Paul nicht gerechnet gehabt. Er hatte sich vielmehr eine zeitbeschränkte Überbrückungshilfe erhofft. Vor Dorothea schämte er sich, dass er sich in seinem Bruders dermaßen getäuscht hatte.
Während der Wochen, in denen sich die „Amerikaner“ in Wien beziehungsweise in Europa aufhielten, wurden Dorothea, Paul und die Kinder von Otto zweimal zu einem Mittagessen, einmal zu einem Spaziergang in den Wienerwald und zu einem weiteren in den Prater eingeladen. Alleine besuchten Otto und Lilly Konzerte, Theater- und Opernaufführungen, jedoch ohne Paul oder Dorothea einzuladen. Ehe das Ehepaar seine Reise von Wien aus fortsetzte, besuchten Otto und Paul das Grab ihrer Eltern auf dem Wiener Zentralfriedhof, 4. Tor. Hinterher beschlossen sie, den arg verwitterten Grabstein herrichten und die Inschrift erneuern zu lassen. Der Abreisetag sowie die Verabschiedung voneinander standen an. Ihre anschließende Reise ging zum Kultur- und Badeurlaub nach Italien und Spanien weiter. Zwischendurch erhielten Paul und Dorothea farbenprächtige Urlaubsgrüße ins Heim gesandt. Mit dem letzten Gruß, der aus Spanien abgesandt wurde, kündigte Otto an, dass sie, sobald der schwere Pontiac verladen sei, per Schiff wieder nach Amerika zurückreisen würden. Zwei Jahre danach kamen sie abermals nach Europa und auch wieder nach Wien. Otto hatte den Pontiac in einen nicht weniger prachtvoll aussehenden Oldsmobile [84] eingetauscht. Dieses Mal kamen sie mit den Gedanken bepackt, Vorkehrungen zu treffen, Amerika den Rücken zu kehren und sich für immer in Wien niederzulassen. An Ottos Haltung zu seinem Bruder hatte sich nichts geändert. Onkel Paul hütete sich davor, jemals wieder auf das leidige Thema hinzuweisen, was auch ganz im Sinne Dorotheas war.
Wie schon den ersten Europaurlaub genossen sie auch den neuerlichen ausgiebig. Abermals erreichten wunderschöne Grußkarten von allerlei mondänen Orten das Heim. Schlussendlich reisten sie ein allerletztes Mal über den großen Teich nach Amerika zurück. Drüben lösten sie ihre Bleibe und alles Dazugehörige und Nötige auf, um zum letzten Mal mit einem Schiff, diesmal für immer, nach Europa zu reisen. Über Paris, wo sich Otto einen neuen, knallgelben, mit schwarzem Dach versehenen Simca Versailles, die eleganteste Ausführung dieser französischen Automarke, kaufte, fuhren er und Lilly in Richtung Österreich, wo sie nach einigen Tagen in Wien eintrafen.
Otto schaffte es tatsächlich, innerhalb kurzer Zeit nach Wien zu übersiedeln und ansässig zu werden. Geld spielte eine nebensächliche Rolle. Es war genug vorhanden, um sich eine geeignete Wohnung im vierten Bezirk in der Seisgasse zu kaufen. Otto ließ diese nach seinen und Lillys Bedürfnissen umbauen. In Nebenräumen richtete er seine Arztpraxis ein. Darüber hinaus nahm Otto nach erfolgreicher Bewerbung auch eine Anstellung als Amtsarzt der Gemeinde Wien an. Diese trug ihm einen weiteren, nicht unbedeutenden Verdienst ein. Schon wenige Jahre danach wurde ihm gar der Titel Medizinalrat verliehen.
Onkel Pauls Psyche hatte zwei Knackpunkte, die ihn seit jeher arg belasteten. Weder Hans noch Erika waren sich dessen als Kinder jemals bewusst, weil es für beide unbedeutend war. Wenn überhaupt, so stach den Kindern höchstens einer während der Anfangsphase ihres Zusammenlebens ins Auge. Einer dieser beiden Knackpunkte war, dass Onkel Paul einige, wenn auch nur wenige, Zentimeter kleiner als Dorothea war; der zweite, dass er von Geburt an eine platt gedrückte Nase hatte. Seine Nase sah aus, als wäre sie von einem Boxhieb platt geschlagen worden. Beides bedrückte ihn. Er war davon überzeugt, deshalb verunstaltet auszusehen, und litt darunter. Trotz allem war er darum bemüht, sich diesbezüglich nichts anmerken zu lassen. Dorothea konnte es nicht begreifen, dass Onkel Pauls Bruder, der Arzt Dr. Otto Braun, nicht wenigstens ein einziges Mal Anstalten machte, seinem Bruder zu einer plastischen Operation zu raten oder ihm zu einer solchen zu verhelfen. Damit wäre Onkel Paul eine große psychische Belastung genommen worden.
12. Gymnasium und erste Liebesgefühle
Hans besuchte mittlerweile die letzte Volksschulklasse. Mutter und Onkel Paul waren sich einig, den Knaben danach in ein Gymnasium einschreiben zu lassen. Er wurde im neunten Bezirk im Wasagymnasium angemeldet und aufgenommen. Dieses Schulgebäude war jedoch kriegsbeschädigt, deshalb provisorisch im Schottengymnasium, welches sich im ersten Bezirk befand, untergebracht. Der Schuldirektor war ein alter, groß gewachsener und Respekt einflößender Herr. Er hieß Dr. Vogelsang. Die Volksschuljahre hindurch hatte Hans ein und dieselbe Lehrerin gehabt. Auf dem Gymnasium waren es auf einmal mehrere Lehrpersonen, von denen jeder ein oder mehrere Fächer unterrichtete. Zudem mussten sie mit „Professor“ oder „Doktor“ angesprochen werden. Sein erster Klassenvorstand lehrte Mathematik. Er hieß Dr. Maximilian Sames und war ein lustiger Pädagoge. Zum Leidwesen der Schüler wurde er ins Krottenbachgymnasium, welches er als Direktor leiten durfte, versetzt. Die frei gewordene Stelle des Klassenvorstandes wurde Frau Dr. Baumann übertragen.
Für den nun wesentlich längeren Schulweg musste Hans die Straßenbahn benützen. Für Schüler gab es ermäßigte Monatsfahrkarten, um die mit einem Formular und einem Lichtbild angesucht werden musste. Auch Hans reichte um eine ermäßigte Karte ein. Sobald alles in Ordnung befunden wurde, erhielt Hans seine Streckenkarte ausgehändigt. Auf dieser war die Strecke vom Wohnort bis hin zur Schule eingetragen, die mit der Karte benutzt werden durfte. Darüber hinaus durfte er auch alle anderen Straßenbahnlinien benutzen, sobald diese Teile der eingetragenen Strecke befuhren. Wichen diese von der eingetragenen Strecke ab, musste er rechtzeitig aussteigen und auf eine Bahn warten, welche die eingetragene Strecke weiter befuhr. Die Gültigkeit der Streckenkarte war auf die Werktage beschränkt und die Streckenkarte mit einer aufgeklebten Marke versehen, die jeden Monatsbeginn erneuert werden musste. Da nun seine Mutter und Onkel Paul endlich einer Beschäftigung nachgehen konnten, verhielt es sich so, dass Hans nach Schulschluss häufig die Ausspeisung in der Leopoldsgasse aufsuchen musste, um dort sein Mittagessen einzunehmen. Wenn er nicht einen Kollegen eine Wegstrecke zu Fuß begleitete, bestieg Hans nach Unterrichtsende die Straßenbahn. Um zur Ausspeisung zu gelangen, war er gezwungen, am Schwedenplatz die Tram zu verlassen und die Strecke bis zum Ausspeisungslokal per pedes zurückzulegen oder von da weg beim Schaffner eine Karte zu lösen. Für das Lösen einer Fahrkarte besaß Hans aber kein Geld.
Eines Tages bestieg er, wie oft davor, eine Garnitur, die eine Teilstrecke des für die Monatskarte berechtigten Weges befuhr. Der Schaffner rief das sich alle paar Schritte wiederholende und von allen Schaffnern gleich monoton klingende „Fahrscheine bitte“. Er ließ den Blick über Fahrgäste und deren Fahrscheine, auch über die von Hans hochgehaltene Streckenkarte gleiten. Dann drehte er sich wieder um und ging in die entgegengesetzte Richtung zurück. Normalerweise musste Hans bis zum Schwedenplatz fahren, dort die Straßenbahn verlassen und die Taborstraße bis zur Leopoldsgasse zu Fuß gehen. Seine Streckenkarte hatte über die Schwedenbrücke in die Taborstraße hinein keine Gültigkeit. Der Fußmarsch bis zur Lokalität der Ausspeisung machte ihm nichts aus, da er liebend gerne zu Fuß unterwegs war. Diesmal ergab es sich, dass er vollends in Gedanken versunken die Straßenbahn am Schwedenplatz zu verlassen vergaß. Dabei hatte er bereits das markante Gebäude der Urania im Blickfeld, auf welche die Straßenbahn nach diesem Halt als nächstes zusteuern sollte. Sein Versäumnis bemerkte er erst, als sich die Garnitur in Bewegung setzte und nicht auf die Urania zufuhr, sondern in die Taborstraße einbog. Ab diesem Moment erfasste ihn die Angst, vom Schaffner entdeckt und als Schwarzfahrer bloßgestellt zu werden. Schon sah er ihn sich von der vorderen Plattform durch das Menschenknäuel im Wageninneren durchzwängen und auf die hintere Plattform, auf der Hans stand, zusteuern. Dann war er da, und es geschah nichts. Hans war ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, und seine Anspannung wich der ursprünglichen Lockerheit. Da ihm nichts geschehen war, beschloss er, die nächsten zwei Stationen, nun bewusst, schwarz weiterzufahren. Weil er dem Schaffner nicht aufgefallen war, nahm sich Hans vor, wenn er das nächste Mal zur Ausspeisung fahren musste, besagte zwei Stationen abermals schwarzzufahren. Es klappte beim nächsten und auch beim übernächsten und einige weitere Male ausgezeichnet. Überhaupt fragte und wunderte sich Hans darüber, wie es möglich war, dass sich ein Schaffner all die Streckenausweiskarten, die ihm oft von Weitem gezeigt wurden, merken konnte? Es war ihm ein unerklärliches Rätsel. Auf einer solchen Fahrt zur Ausspeisung stieß Hans einmal auf einen Schaffner, der ihn eines Besseren belehren sollte. Hans war beim Gymnasium in die Straßenbahn eingestiegen, hielt dem Schaffner, sowie er diesen herannahen sah, seine Streckenkarte mit ausgestrecktem Arm entgegen. Dieser streifte seine und weitere ihm entgegengehaltene Streckenkarten mit flüchtigem Blick, kehrte um und ging durch das Wageninnere wieder zur anderen Plattform zurück. Bei jeder Station, an der die Garnitur anhielt, ertönte von draußen das Geschrei der Zeitungsverkäufer, die lauthals ihre Blätter, deren gängige Namen „Wiener Kurier“, „Weltpresse“, „Express“ und „Der Abend“ lauteten, anpriesen. Die Straßenbahn hatte den Schwedenplatz erreicht und bog in die Taborstraße ein. Abermals bewegte sich der Schaffner von der vorderen Plattform auf jene zu, auf welcher Hans stand. Doch diesmal stellte sich der Schaffner so hin, dass er sich zwischen Hans und dem offen stehenden Ein- und Ausstieg befand. Er forderte ihn auf, die Streckenkarte nochmals vorzuweisen. Hans griff in seine Tasche, holte die Karte hervor und zeigte sie ihm. Zugleich rutschte ihm sein Herz in die Hose. Nachdem ihn der Schaffner, für die anderen Fahrgäste kaum hörbar, gefragt hatte, warum er verbotenerweise auf dieser Strecke fahre und Hans ihm wahrheitsgemäß von der Ausspeisung erzählte, milderte sich dessen strenger Blick. Er wies Hans an, die Karte wieder einzustecken. Weiterhin nur für Hans vernehmbar, flüsterte ihm der Schaffner zu, dass, wenn Hans ihn in Zukunft in einer Straßenbahn entdecken sollte, er jedes Mal mit ihm mitfahren dürfe und keine Konsequenzen zu befürchten habe. Mit kurzem Kopfnicken bedankte sich Hans, stieg nach der zweiten Station aus dem Straßenbahnwagen aus und fühlte sich erst, als er sich auf der Straße befand, wirklich erleichtert. Hans hielt sich daran, nur noch dann schwarzzufahren, wenn er diesen Schaffner in einer Garnitur erblickte, was ab und zu tatsächlich zutraf.
Im Gymnasium lief vieles anders ab als zuvor in der Volksschule. Seine neuen Mitschüler bestanden aus einem Drittel Mädchen, und die Lehrer wurden wie erwähnt entweder mit „Professor“ oder „Doktor“ angesprochen. Von Mal zu Mal gab es mehr und mehr zu lernen, was Hans große Probleme bereitete. Auf sich alleine gestellt, war er aus Verspieltheit und Gleichgültigkeit zum selbständigen Lernen unfähig. Er wollte sich dazu niemals ernsthaft durchringen. Ihm stand niemand zur Seite, der ihn zum Lernen angehalten, beaufsichtigt und ihm bei schulischen Aufgaben geholfen hätte. Genau solch eine Person hätte Hans unbedingt gebraucht. Abends, wenn Mutter und Onkel Paul heimkamen, hatten sie andere Sorgen, als Hans nach gemachten – meist nicht gemachten – Aufgaben oder über Schulprobleme zu befragen. Er wiederum hütete sich sehr, diesbezügliche Themen auch nur im Entferntesten anzuschneiden. So konnte es nicht ausbleiben, dass bei ihm bereits nach dem ersten Schuljahr eine Nachprüfung in Englisch anstand. Sowie seine Mutter von der Schulleitung davon in Kenntnis gesetzt wurde, zeigten sowohl sie wie auch Onkel Paul sich über ihn sehr enttäuscht. Hans wurde von beiden mit Vorwürfen bedacht. Nachdem sich Dorothea und Onkel Paul Gedanken über das weitere Vorgehen mit Hans gemacht und dies durchdiskutiert hatten, entschieden sie, für Hans über die Dauer der nun verpatzten Ferien einen Studenten als Nachhilfelehrer zu engagieren. Der sollte mit ihm pauken und erreichen, dass Hans die Nachprüfung besteht und in die nächste Klasse aufsteigen kann. Es war eine Menge Geld, das Mutter und Onkel Paul für die Nachhilfestunden ausgaben, das sie viel nötiger für den Erwerb anderer Sachen benötigt hätten. Schlussendlich bestand Hans die Nachprüfung bei Professor Doppler. Hans hatte daraus, dass er seine Ferien vergeudet hatte, jedoch nichts gelernt, was das eigenständige Lernen anbelangt. Er schlitterte auch im neuen Schuljahr ins gleiche Fahrwasser wie zuvor. Wenn überhaupt, so lernte er selten, und dann nur das Allernotwendigste. Hätte er sich nur etwas bemüht, wäre er ein ausgezeichneter Schüler gewesen. Hausaufgaben machte er unregelmäßig, oftmals erst kurz vor Unterrichtsbeginn. Häufig ließ ihn sein Schulfreund Roland Bardy aus dessen Erarbeitetem abschreiben.
In den leider so rasch verlaufenen zwei Jahren, in denen Hans das Wasagymnasium besuchte, war Roland sein bester Schulfreund geworden. Nicht deshalb, weil jener einer der besten Schüler war und ihn oft abschreiben ließ, sondern, weil sie sich abwechselnd öfter nach Unterrichtsschluss ein Stück auf dem Nachhauseweg begleiteten. Unter den Mitschülerinnen gab es einige, die hübsch, sogar sehr hübsch aussahen. Auf ein Mädchen hatten mehrere Klassenkameraden ein Auge, Roland und Hans längst schon beide, geworfen. Das Mädchen hieß Vera Korn. Vera war sehr schlank und trug ihr hellblondes Haar immer zu einem neckischen Pferdeschwanz frisiert. So sie Hans ansah, was meist verstohlen getätigt geschah, strahlte ihm ihr grünes Augenpaar entgegen. Eine andere Mitschülerin hieß Elisabeth Schubert. Sie war ein rassig aussehendes, stolzes Mädchen, das ihr schwarzes, dickes, langes Haar zu Zöpfen geflochten trug. Nicht ungenannt sollen Helga Holobek und Ingeborg Lesiow, beide brünettblond, bleiben. Beide zählten ebenfalls zu den hübschen Mitschülerinnen. Helga war die Busenfreundin von Vera. Fast täglich wurde Vera von Helga in die Rossauer Lände nach Hause begleitet. Natürlich hatten Hans und Roland dies bemerkt gehabt. Deshalb trotteten beide den Mädchen im Abstand von etwa dreißig Metern hin und wieder hinterher, wobei viel geschäkert wurde. Langten sie bei Veras Wohnhaus an, verschwanden die Mädchen im Haus, um kurz danach auf dem straßenseitig gelegenen Balkon zu erscheinen. Von diesem herab wurde eine Weile mit den auf der gegenüberliegenden Straßenseite harrenden Knaben weitergeflirtet. Nach einer Weile kam allen in den Sinn, dass noch anderes zu tun sei. Also zogen sich die Mädchen vom Balkon in die Wohnung zurück, und die Knaben schritten, Roland den kürzeren, Hans den wesentlich längeren Weg vor sich habend, ihren Heimen zu.
Im Klassenzimmer saß Vera in der ersten Reihe, Hans hingegen ziemlich weit hinten. Hans hatte sich, in der irrigen Annahme, dort seltener von den Professoren aufgerufen und geprüft zu werden, absichtlich nach hinten gesetzt. Dennoch suchten und trafen sich zwischendurch Blicke von Vera und Hans. Sooft Vera Hans einen Blick zuwarf, strahlte der in Vera unheimlich verliebte Zwölfjährige. Roland hatte die hübsche Vera gleichfalls ins Auge gefasst, doch mehr Chancen bei ihr – welche überhaupt? – räumte sich Hans ein.
Im Wasagymnasium gab es nur zwei Professoren, von denen Hans jemals ein Lob erfahren hatte. Der eine war der Zeichenprofessor Katzer, der andere der, der Biologie unterrichtete. Der Letztgenannte, der Gebhardt hieß, war Hans äußerst wohlgesonnen. Hans verscherzte es sich mit jenem aber einmal für eine Weile aus folgendem Grund: Hans hatte aus reiner Verspieltheit eine schriftliche Hausarbeit, bei der es um das Pferd ging, nicht gemacht gehabt. Beim Biologieunterricht rief der Professor ausgerechnet Hans auf, die Schreibarbeit aus seinem Heft vorzulesen. Hans stand auf, öffnete sein Heft, in welchem nichts geschrieben war, hielt es, die leere Seite anstarrend, vor sich hin und begann stotternd etwas zu zitieren. Professor Gebhardt merkte bereits nach den ersten dahergestammelten Sätzen, dass Hans keine Aufgabe gemacht haben konnte. Er forderte ihn auf, nach vor zu kommen und ihm das Heft zu zeigen. Damit war der Schwindel aufgeflogen und Hans mit einer schlechten Note beurteilt worden.
13. Endlich eine eigene Wohnung
Es war Jahresende 1952. Dorothea kam freudestrahlend wie niemals zuvor nach Hause. Sie hatte die Mitteilung erhalten, dass ihnen endlich eine Gemeindebauwohnung, und zwar im zwölften Bezirk, zugeteilt worden war. Dabei handelte es sich um einen Gemeindeneubau, den sie im Frühjahr 1953, bis dahin sollte er fertiggestellt sein, beziehen konnten. Die plötzliche Zuteilung auf eine eigene Wohnung hatte ihren Grund. Einige Zeit davor waren sie und Onkel Paul auf Anraten ihnen Wohlgesinnter aus der KPÖ ausgetreten und zur SPÖ, der Sozialdemokratischen Partei Österreichs [85], übergewechselt. Nur dann, so wurde gemunkelt, würde die Chance auf eine Zuteilung einer Gemeindewohnung für sie steigen. Über diese so viele Jahre herbeiersehnte Nachricht freuten sich alle. Um ihre übergroße Neugier etwas zu mindern, fuhren Onkel Paul und die Kinder wenige Tage danach zu dem sich noch im Rohbau befindlichen Wohnblock, um ihr zukünftiges Zuhause zu besichtigen. Noch waren einige Arbeiter mit Ausmalen, Anbringen von Fußbodenleisten und ähnlichen Tätigkeiten beschäftigt oder dabei, diese zu vollenden. Keiner ließ sich dabei von den drei Besuchern stören. Als sie die ihnen riesig vorkommende Wohnfläche von 52 Quadratmetern betraten, kam Hans aus dem Staunen nicht heraus. Er konnte sich nicht und nicht vorstellen, was man mit so viel Platz anfangen sollte. Sogar fließendes Kalt- und Warmwasser, ein eigener Gasherd mit vier Flammen, ein Duschraum und ein Klosett, welches sich in der Wohnung befand, waren vorhanden. Straßenseitig gelegen war an den als Schlafzimmer vorgesehenen Raum sogar ein Balkon angebracht. Noch war Hans sich dessen nicht bewusst, dass er sich schon bald, mit Ausnahme der Zeit in Basel – erstmals in seinem bisherigen Leben und dies mit über dreizehn Jahren –, innerhalb eigener vier Wände erstmals richtig waschen können werde. Nachdem sie sich sattgesehen hatten, fuhren sie schwärmend und vielerlei Pläne schmiedend, rege plaudernd ins Heim zurück.
Hans stand wie sein Freund Heini nun im dreizehnten Lebensjahr. Das bedeutet bei Juden, dass ihm die Bar Mitzwa [86], das Zum-Mann-Erhoben-werden, bevorstand. Hans, der sich nicht nur im Gymnasium, sondern auch im jüdischen Religionsunterricht keine Meriten [87] erworben hatte, musste nun eine Anzahl Gebete, zudem in hebräischer Sprache, erlernen. Zu seinem Glück hatte er in der Ungarin Frau Pollermann, einer Nachbarin im Heim, beim Lernen für seinen großen Auftritt im Stadttempel Wiens eine große Stütze. Sie konnte Hebräisch lesen und half ihm, alle Gebete, die sie ihm in liebenswerter Weise zuvor phonetisch aufgeschrieben hatte, auswendig zu lernen. Zusätzlich mussten Hans und Heini gemeinsam einen sehr alten Herrn, er hieß Harmelin, aufsuchen und mit jenem, er wohnte im Gebäude der Synagoge in der Seitenstettengasse, weitere Gebete durchackern. Vor allem mussten die beiden Knaben bestimmte Gepflogenheiten des Zeremonienablaufes während der Bar-Mitzwa-Feier mit jenem üben. Besagter Alter hatte es beim Unterrichten mit den Knaben keineswegs leicht. Jene konnten zwischendurch oft ein grundloses Lachen nicht und nicht unterdrücken, womit sie den Lernablauf häufig unterbrochen haben.
Da erwiesenermaßen der Großteil aller Verwandten von Hans „aus dem Weg geräumt“ worden waren, von denen mit Sicherheit einige die Patenschaft zu seiner Bar Mitzwa gerne übernommen hätten, wurde ihm von der Kultusgemeinde ein ihm fremder Herr zur Seite gestellt. Dies war ein bessergestellter Herr, der sich für solche Gegebenheiten ehrenhalber als Pate zur Verfügung stellte und diesmal Hans begleitete. Davor lud er Hans ein, mit ihm in die Mariahilfer Straße zum Modegeschäft „Haber“ zu fahren, um für den Knaben einen grauen Esterhazy-Maßanzug [88] anfertigen zu lassen. Diese Kleidung war und blieb für Hans lange Zeit sein erster und einziger Anzug. Dermaßen elegant gekleidet begab sich Hans termingerecht in Begleitung von Mutter, Erika und Onkel Paul zur angesetzten Feier in den Tempel. Der Oberrabbiner war Herr Akiba Eisenberg [89].
Der baldige Wohnungswechsel stand bevor, als bei ihnen ein Schreiben vom Stadtschulrat eintraf. In diesem wurde Hans zu einem Schulwechsel aufgefordert. Das Schreiben wies ihn weiter an, dass er, sowie der Wohnungswechsel stattgefunden hatte, in eine seinem Wohnort näher gelegene Schule überwechseln müsse. Die neue Schule war ein Realgymnasium im 15. Bezirk in der Diefenbachgasse. Diese Meldung traf ihn hart. Für Hans hieß es, sich von seinem lieb gewordenen „Spezi“ Roland zu verabschieden und seinen Schwarm Vera aus den Augen zu verlieren. Durch die Turbulenzen des im Frühjahr 1953 in Angriff genommenen und rasch vollzogenen Umzuges von der Tempelgasse, in welcher er mit Mutter, Schwester und Onkel Paul an die sieben lange Jahre gehaust hatte, in den zwölften Bezirk kam Hans nicht mehr dazu, sich von seinen ihm lieb gewesenen Mitschülern zu verabschieden.
Anhang: Was aus ihnen geworden ist (Stand 2007)
Dorothea, geboren 1918, gestorben 1983, war Fremdenführerin.
Erika, geboren 1942, ist seit 2002 Hauptschul-Oberlehrerin in Pension.
Hans, geboren 1940, war Mâitre d´hôtel und Vertreter und ist seit 2005 Pensionist.
Onkel Paul, geboren 1907, gestorben 1961, war Musiker.
Lilly und Otto Braun, gestorben in den 1970er-Jahren, waren Hausfrau und Arzt.
Vic, seine Gattin Nori und deren Kinder leben in den USA, Nori starb 2003, Vic am 29. April 2007.
[1] Systematische Vertreibung und Ermordung der Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten.
[2] Thessaloniki wurde wegen seiner großen jüdischen Gemeinde auch „Jerusalem des Balkans“ genannt.
[3] Als „Kristallnacht“ oder „Reichskristallnacht“ wurde der Pogrom gegen Jüdinnen und Juden auf deutschem Reichsgebiet in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 bezeichnet. Der Name leitet sich von den zahlreichen Fensterscheiben, die im Zuge dieser Nacht zerstört wurden, ab. Neben der Plünderung, Zerstörung und Beschlagnahmung von jüdischen Geschäften, Wohnungen, Synagogen und Bethäusern wurden tausende Jüdinnen und Juden verhaftet und zum Teil in Konzentrationslager deportiert, wo viele von ihnen ermordet wurden.
[4] Textzeile aus dem von den Nationalsozialisten zu Propagandazwecken eingesetzten Lied „Es zittern die morschen Knochen“ des NS-Funktionärs Hans Baumann (1914-1988).
[5] Die Deutsche Wehrmacht griff Jugoslawien am 6. April 1941 an. Am 17. April 1941 kapitulierten die jugoslawischen Streitkräfte.
[6] Franz Kafka (1883–1924), deutschsprachiger Prager Schriftsteller jüdischer Herkunft.
[7] In den mazedonischen Städten Skopje, Bitola (damals auch Monastir genannt) und Štip nahmen am 11. März 1943 bulgarische Polizei- und Militäreinheiten – Mazedonien war seit 1941 von Bulgarien besetzt – mehr als 7.000 Jüdinnen und Juden, darunter rund 2.300 Kinder, fest und internierten sie zunächst in einer Tabakfabrik in Skopje. Ende März 1943 wurden sie in Viehwaggons in das Vernichtungslager Treblinka in Polen deportiert, wo sie ermordet wurden.
[8] Im Zuchthaus Brandenburg-Görden wurden während der NS-Zeit mehr als 2.000 politische GegnerInnen des NS-Regimes hingerichtet.
[9] ZeugInnen Jehovas wurden als staatsfeindlich angesehen, da sie aufgrund ihrer religiösen Überzeugung sowohl die Teilnahme an staatlichen NS-Organisationen als auch „Hitlergruß“, Fahneneid und Kriegsdienstleistung ablehnten. Bis 1945 wurden im Deutschen Reich insgesamt rund 2.000 ZeugInnen Jehovas in Konzentrationslagern interniert und rund 250 Personen wegen Kriegsdienstverweigerung hingerichtet.
[10] Auch heute noch als Justizvollzugsanstalt verwendetes Gefängnis in Bayern. Während der NS-Zeit gingen von hier aus mehrere Transporte mit inhaftierten Frauen in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz in Polen.
[11] Als „U-Boote“ werden jene vom NS-Regime verfolgten Menschen bezeichnet, die versuchten, die NS-Zeit durch Untertauchen und Leben im Verborgenen zu überstehen.
[12] Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Österreich von den alliierten Siegermächten in vier militärische Besatzungszonen eingeteilt: die sowjetische, US-amerikanische, französische und britische.
[13] Pferd mit weißem Fell mit dunklen, apfelförmigen Flecken.
[14] Das American Jewish Joint Distribution Committee war nach dem Zweiten Weltkrieg die wichtigste Hilfsorganisation für überlebende Jüdinnen und Juden in Europa.
[15] Maria Cebotari (1910–1949), russisch-rumänisch-österreichische Opernsängerin.
[16] Gustav Diessl (1899–1948), österreichischer Schauspieler.
[17] Hans Duhan (1890–1971), österreichischer Opernsänger.
[18] Diese Synagoge in Wien 2., Tempelgasse 3, der so genannte Leopoldstädter Tempel, wurde zwischen 1854 und 1858 im maurischen Stil errichtet und während des Novemberpogroms 1938 fast völlig zerstört.
[19] Friedrich Nietzsche (1844–1900), deutscher Philologe und Philosoph.
[20] Öffentliche Bade- und Waschanstalten, in denen Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten, deren Wohnungen über kein eigenes Badezimmer verfügten, Bäder nehmen konnten.
[21] Die SS („Schutzstaffel“), ursprünglich eine kleine paramilitärische Formation der NSDAP, entwickelte sich zu einer der größten und mächtigsten Organisationen des „Dritten Reichs“ und machte sich im Zweiten Weltkrieg unzähliger Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig.
[22] Abkürzung für Geheime Staatspolizei. Die Gestapo war die Politische Polizei des NS-Staates, und ihre Aufgabe war die Bekämpfung und Verfolgung politischer GegnerInnen.
[23] Auch Schabbat (hebräisch für „Ruhetag“): Der siebente Tag in der Woche, an dem keine Arbeit verrichtet werden darf.
[24] Orthodoxe jüdische, verheiratete Frauen sollen nach der Halacha, dem jüdischen Recht, ihr Haar verdecken, etwa mit Perücken, Kopftüchern oder Ähnlichem.
[25] Ehemalige Bar mit Varietébetrieb im 1. Bezirk in Wien.
[26] Die alliierten Besatzungsbehörden hatten 1945 eine "Österreichische Zensurstelle" errichtet, die noch bis 1953 Auslandspost zensurierte.
[27] Im Nestroyhof, einem 1898 errichteten Jugendstilgebäude am Nestroyplatz, das ursprünglich als Zentrum für jüdische Kultur diente, befand sich in der Nachkriegszeit unter anderem das Nestroy-Kino. Heute beherbergt das Gebäude das Theater Nestroyhof Hamakom.
[28] Hermann Leopoldi (1888–1959), populärer österreichischer Komponist und Kabarettist.
[29] Konzert- und Veranstaltungslokal im Wiener Stadtpark.
[30] Im Jahr 1916 errichtetes Kino in der Taborstraße 8, das mit ursprünglich über 1.000 Sitzplätzen eines der größten Kinos in Wien war. 1996 wurde es geschlossen.
[31] Oper des russischen Komponisten Modest Mussorgski (1839–1881) nach einer literarischen Vorlage des russischen Dichters Alexander Puschkin (1799–1837).
[32] Ljuba Welitsch (1913–1996), bulgarisch-österreichische Opernsängerin und eine der bedeutendsten Sängerinnen des 20. Jahrhunderts. Die Titelpartie in „Salome“ des deutschen Komponisten Richard Strauss (1864–1949) war eine ihrer wichtigsten Rollen.
[33] Siehe Fußnote 27.
[34] Das Carltheater wurde 1847 in der Praterstraße 31 eröffnet. Es wurde 1944 bei einem Bombenangriff fast völlig zerstört und 1951 schließlich abgerissen. Heute steht an seiner Stelle der Galaxy Tower.
[35] „Glückstreffer“: Gut platzierter Schlag des schwächeren Boxers, der damit den Kampf gewinnt.
[36] Die so genannte Internationale Patrouille, auch als die „Vier im Jeep“ bezeichnet, setzte sich aus je einem Militärpolizisten der vier alliierten Besatzungsmächte zusammen und fuhr zum Schutz der Ordnung und der Sicherheit der Zivilbevölkerung und der Angehörigen der alliierten Armeen während der Besatzungszeit 1945 bis 1955 in Wien regelmäßig auf Streife.
[37] Diebesgut (ursprünglich aus dem Jiddischen bzw. Hebräischen für „Ware“).
[38] „Der junge Wächter“: zionistische Jugendbewegung.
[39] Mesusa (hebräisch für „Türpfosten“): am Türpfosten angebrachte Schriftkapsel, in der kleine Pergamentrollen, auf die Teile des täglichen Gebets „Schma Jisrael“ geschrieben sind, aufbewahrt werden.
[40] Die jüdischen Speisegesetze unterscheiden zwischen koscheren (jiddisch für „erlaubt“) und nicht koscheren Tieren, verbieten den Blutgenuss und unterteilen Lebensmittel neben neutral in fleischig und milchig, wobei diese getrennt voneinander zubereitet und verzehrt werden müssen.
[41] Erbsenreis.
[42] Kommunistische Partei Österreichs.
[43] Josef Stalin (1878–1953), von 1927 bis 1953 sowjetischer Diktator.
[44] Veraltet für: Ansager, Moderator bei Veranstaltungen.
[45] Max Lustig (1906–1982), österreichischer Schauspieler und Conferencier.
[46] Else Rambausek (1907–1994), österreichische Schauspielerin und Sängerin,
[47] Richard Eybner (1896–1986), österreichischer Schauspieler.
[48] Rotarmisten: Angehörige der „Roten Arbeiter- und Bauernarmee“ (kurz: Rote Armee, ab 1946 offiziell: Sowjetarmee), die das Heer und die Luftstreitkräfte der Sowjetunion umfasste.
[49] Auch: Serge Jaroff (1896–1985), US-amerikanischer Chorleiter russischer Herkunft. Jaroff gründete Anfang der 1920er-Jahre in einem Internierungslager in der Türkei den „Chor der Don Kosaken“, der aus vertriebenen kosakischen Kämpfern der zarentreuen „Weißen Armee“ bestand und bis in die 1970er-Jahre vor allem in den USA und Europa große Erfolge feierte.
[50] Deutsche Nachdichtung eines russischen Arbeiterliedes, das vor allem von der Arbeiterbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg oft gesungen wurde. Es war aber auch von den Nationalsozialisten mehrfach umgedichtet worden und war in dieser Form auch ein bekanntes Propagandalied der NSDAP.
[51] Bezeichnung für die Gegend um das heutige Karmeliterviertel im zweiten Bezirk in Wien, die auf die jüdische Vergangenheit dieses Viertels hinweist. Als „Mazze“ oder auch „Matze“ wird das ungesäuerte Brot bezeichnet, das traditionellerweise beim Pessach-Fest gegessen wird.
[52] Elfmeter beim Fußball.
[53] DKW: ehemalige deutsche Auto- und Motorradmarke.
[54] Ernie Bieler (1925–2002), österreichische Jazz- und Schlagersängerin.
[55] Rudi Hofstetter (1916–2008), österreichischer Entertainer und Schlagerstar.
[56] Gretl Schörg (1914–2006), österreichische Operettensängerin und Schauspielerin.
[57] Emmerich Arleth (1900–1965), österreichischer Entertainer und Schauspieler.
[58] Franz Schier (1909–1954), österreichischer Schlager- und Wienerliedsänger und Filmschauspieler.
[59] Ernst Arnold (1890–1962), österreichischer Komponist und Sänger von Wienerliedern.
[60] Maria Andergast (1912–1995), österreichische Schauspielerin und Sängerin.
[61] Hans Lang (1908–1992), österreichischer Komponist von Film- und Bühnenmusik und Sänger.
[62] Musiksendung des US-amerikanisch kontrollierten Rundfunksenders Rot-Weiß-Rot.
[63] Bakelit – benannt nach dessen dänischem Erfinder Leo Hendrik Baekeland (1863–1944) – ist eine spezielle Art von Kunststoff und kommt unter anderem als Gehäuse für verschiedene Haushaltsgeräte wie Telefone, Transformatoren, Lichtschalter, Steckdosen etc. zum Einsatz.
[64] Heribert Meisel (1920–1966), österreichischer Sportjournalist.
[65] „Die Radiofamilie Floriani“, Hörspielserie, die vom Sender Rot-Weiß-Rot ausgestrahlt wurde.
[66] Wunschkonzertsendung des unter sowjetischer Kontrolle stehenden Senders Radio Wien.
[67] Halleiner Motorenwerke AG: ehemaliger österreichischer Moped-Hersteller.
[68] Sowjetischer Märchenfilm, 1946.
[69] Auch: „Nasreddin in Buchara“, sowjetische Filmkomödie, 1943.
[70] Josef Eisemann (1911–1949), Hochseilartist. Eisemann stürzte mit seiner Tochter Rosa am 17. Juli 1949 bei der Überquerung des Donaukanals auf dem Hochseil in den Tod.
[71] Die deutschen Philosophen, Ökonomen und Gesellschaftstheoretiker Karl Marx (1818–1883) und Friedrich Engels (1820–1895) schufen mit dem so genannten Marxismus die theoretischen Grundlagen des modernen Kommunismus. Der russische Revolutionär und spätere Begründer der Sowjetunion, Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924), entwickelte den Marxismus unter dem als Leninismus gebräuchlichen Begriff weiter.
[72] Rudolf Bing (1902–1997), in Wien geboren, flüchtete 1933 vor den Nationalsozialisten aus Berlin nach Großbritannien und war von 1950 bis 1972 Leiter der New Yorker Metropolitan Opera.
[73] ELIN Aktiengesellschaft für elektrische Industrie: österreichisches (als GmbH heute noch existierendes) Unternehmen, das unter anderem auf Generator-, Trafo-, Leitungs- und elektrischen Anlagebau spezialisiert war.
[74] Weihnachtsmann in Russland, der auf einer russischen Märchenfigur basiert und in der Neujahrsnacht Geschenke an die Kinder verteilt.
[75] Am 25. Tag des jüdischen Monats Kislew (November/Dezember) beginnendes jüdisches Fest (auch Lichterfest genannt), das acht Tage lang dauert und der Wiedereinweihung des Zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. gedenkt.
[76] Wichtiges jüdisches Fest (auch Fest der ungesäuerten Brote genannt), das an den Auszug der Israeliten aus Ägypten erinnert und im jüdischen Monat Nisan (März/April) gefeiert wird.
[77] Synonym für die Nationalsozialisten, deren Kennfarbe Braun war.
[78] Anton Freiherr von Eiselsberg (1860–1939), österreichischer Chirurg, von 1901 bis 1931 Vorstand der Ersten chirurgischen Universitätsklinik Wien.
[79] Hans Faltl (1900–1972) bewarb sich 1939 um eine nach dem zwangsweisen Ausscheiden der jüdischen Mitglieder frei gewordene Stellung als Geiger bei den Wiener Philharmonikern und wurde 1940 als Mitglied aufgenommen. Er war ein beliebter Balldirigent und mit seinem Schrammelquartett häufig bei offiziellen Anlässen engagiert und machte sich auch als Rathaus-Kapellmeister einen Namen.
[80] Die RAVAG, die Vorgängerin des ORF, nahm im Oktober 1924 mit dem ersten österreichischen Sender Radio Wien ihren regulären Sendebetrieb auf.
[81] Erich Kunz (1909–1995), österreichischer Opernsänger und Interpret von Wienerliedern.
[82] Fritz Imhoff (1891–1961), österreichischer Operetten- und Wienerliedsänger und Filmschauspieler.
[83] US-amerikanische Automarke.
[84] US-amerikanische Automarke.
[85] Von 1945 bis 1991 hieß die Partei Sozialistische Partei Österreichs, danach bis heute Sozialdemokratische Partei Österreichs.
[86] Bar Mitzwa (für Mädchen: Bat Mitzwa) bezeichnet das jüdische Übergangsritual, mit dem der Knabe die religiöse Mündigkeit erreicht.
[87] Verdienst.
[88] Anzug aus Glencheck-Stoff, einem Stoff mit einer speziellen Karomusterung, die aus schottischer Clantracht entstanden ist. In Österreich wird diese Musterung „Esterhazy“ genannt.
[89] Akiba Eisenberg (1908–1983), erster Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien nach dem Zweiten Weltkrieg.