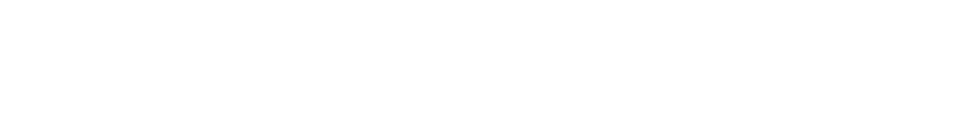Katja Sturm-Schnabl
Aus den Erinnerungen eines Kindes an die NS-Zeit
1936 geboren, wuchs ich mit meiner Schwester Veronika, meinen Brüdern Andrej und Franci auf einem Bauernhof in der Nähe von Klagenfurt in einer slowenischen Großfamilie heran.
Neben den Eltern, Großeltern und zwei Tanten lebten im bäuerlichen Haushalt auch sechs oder acht Arbeiter, zu Erntezeiten kamen noch Taglöhner hinzu. Alle diese Erwachsenen haben uns Kinder als vollwertige Menschen behandelt, ließen uns teilhaben am Geschehen, nahmen uns aufs Feld und in die Stallungen mit, beantworteten lächelnd, aber ernsthaft unsere Fragen. Nie habe ich auch nur ein grobes Wort gehört, niemals eine Ohrfeige auch nur angedroht bekommen. Es gab so spannende Ereignisse wie ein neugeborenes Fohlen oder Kalb, einen Wurf frischer Ferkel, junge Hunde oder Katzen, Lämmer, Küken, Wiesen voller bunter Blumen, einen Bach mit Fischen, Krebsen und Muscheln, einen Wald, wo man Beeren pflücken und Pilze sammeln konnte. Oft kamen Freunde oder Verwandte zu Besuch. Wie aufregend, wenn sie im Empfangszimmer im ersten Stock bei gedeckter Tafel saßen und mit den Großeltern und Eltern Gespräche führten. Da konnte man still in einer Ecke sitzen und so viele Dinge über die Welt außerhalb der unseren erfahren. Anlässlich eines solchen Besuches dräute mir erstmals, dass unsere Welt, in der mein Vater und meine Mutter die oberste Autorität darstellten, bedroht war. Der Besuch, ein Familienfreund, hatte eine Landkarte Europas mitgebracht, sie an die Wand gehängt, um meinem Großvater und allen anderen eine Situation zu erklären, in der die "Nemci" (die Deutschen) furchterregende und bedrohliche Dinge unternahmen, die auch zu uns kommen könnten.

Und eines Tages, an einem Donnerstag, als mein Vater und meine Mutter in der Stadt waren, kamen sie. In Uniformen, mit Stiefeln, aufgepflanzten Gewehren, mit Pistolen und militärischen Kappen auf dem Kopf. Sie stürmten ins Haus, brüllten in abgehackten Sätzen unverständliche Dinge (ich verstand ja als Kind gar nicht Deutsch), und sofort entstand im Haus ein unbeschreibliches Chaos. Meine Tanten weinten, es weinten auch die Mägde – alles lief kopflos durcheinander, die "Nemci" brüllten dazwischen, und mich erfasste totale Panik, weil meine Eltern ja nicht da waren. Ich versteckte mich, bis sie wieder heimgekehrt waren. Meine Mutter begann dann mit versteinertem Gesicht, uns vier Kinder (der jüngste Bruder Franci war zweieinhalb Jahre alt, meine Schwester Veronika sieben, mein Bruder Andrej fünf und ich selbst sechs Jahre alt) anzukleiden. Einige Säcke wurden herbeigeholt und etwas Kleidung und Ähnliches hineingeworfen. Dann mussten wir – die Eltern, die Tanten und wir Kinder (der Großvater lebte inzwischen nicht mehr, die Großmutter war auf Besuch bei der Tante, ihrer dritten Tochter) – Haus und Hof verlassen. [1] Links und rechts die "Nemci", dazwischen wir, so wurden wir abgeführt, mussten durchs Dorf und weiter zu Fuß etwa zwei Kilometer bis zur Straße. Der rote Autobus, der an der Straße gewartet hatte, brachte uns an einen Ort, an dem viele lang gestreckte, niedrige Holzbaracken innerhalb einer Stacheldrahtumzäunung standen. [2] In einer solchen trafen wir unsere Großmutter mütterlicherseits, eine uralte, gebrechlich zierliche kleine Frau (sie war damals 83 Jahre alt), sie lag in dieser Baracke auf Stroh (wie wir es bei uns zu Hause für die Kühe aufgestreut hatten), neben ihr das jüngste Kind meines Onkels (ein sechs Wochen altes Baby – Maks). Als sie meine Mutter erblickte, sagte sie immer wieder: "Nemci nas nekam vlečejo." ("Die Deutschen schleppen uns irgendwohin.") Ja, und rund um die Baracken waren diese "Nemci", in Uniformen, mit Kappen auf dem Kopf, mit Stiefeln, Gewehren, Pistolen und Gesichtern ohne Lächeln, so böse dreinblickend, wie ich mir die Bösewichte in den Märchen immer vorgestellt hatte. Einer von ihnen fotografierte meine Mutter mit uns, und als er weg war, sagte sie voller Verachtung: "Und im Moment meiner tiefsten Erniedrigung hat er die Unverfrorenheit, mich auch noch zu fotografieren."
Nach drei Tagen wurden wir und all die Menschen, die in diesen mit Stroh ausgestreuten "Stallungen" hausten, unter denen so viele Freunde und ehemalige Besucher meiner Eltern und so viele Onkeln, Tanten, Cousinen und Cousins waren, wieder weitergetrieben. Wir erreichten Waggons, in die wir hineingepfercht wurden, die Türen wurden geschlossen – und es herrschte tiefe Finsternis. In dieser Finsternis nun rollten wir dahin, Tage, Nächte – unendliche, ewige Zeiten. Zwischendurch versuchte manchmal jemand ein Zündholz zu entzünden, andere schrieen hysterisch auf, aus Furcht vor Feuer, dazwischen Versuche zu beruhigen. Meine Mutter hielt uns alle vier an sich gepresst wie eine Henne ihre Küken, was für mich das Gefühl der Eingeengtheit noch erhöhte.
Nach dieser nicht enden wollenden Finsternis, Angst, Hysterie, Hilflosigkeit im rollenden Zug in versperrten Viehwaggons dann Stillstand, die Türen wurden aufgerissen und wir taumelten ins gleißende Licht. Die Bahnstation hieß Glasow (in der Nähe von Stettin/Gdansk). Wieder wurde unser armseliger Haufen irgendwohin getrieben. Wir marschierten über eine staubige Straße, meine Mutter presste uns an sich, am Straßenrand Menschen, die uns anstarrten.
Dann Ankunft bei einem riesigen Gebäude – dem Lager. [3] Personal, das uns – Männer, Frauen – brüllend Zimmer zuwies. Dann mussten sich alle nackt ausziehen und wurden in den Keller in eine Duschanlage hineingetrieben. Ich werde nie das entsetzt verschreckte Gesicht meiner Tante vergessen. Wie sie mir später erzählte, war sie überzeugt, dass es Todesduschen waren.
Erinnerungen an das Essen: Wir Kinder wurden von den Eltern getrennt und in einem "Kinderspeisesaal" abgefüttert. An den Tischen schritt der Lagerführer mit blank gewichsten Stiefeln, in denen eine Peitsche steckte, und mit einem großen Schäferhund auf und ab. Ich konnte und wollte diese Zwangsnahrung nicht essen. Bei jedem Mal, wenn der Lagerführer mit seinem Hund, den gewichsten Stiefeln und der Peitsche an meinem Tisch vorbeischritt, brüllte er lauter und bösartiger etwas, was ich zwar nicht verstand, wohl aber begriff, dass es "aufessen" heißen musste. Und obwohl ich mir bereits lebhaft vorstellte, dass er mich vom Hund zerreißen lassen würde, konnte ich und wollte ich nichts essen. Meine Schwester Veronika versuchte, mir zuzureden, doch ich wollte nicht, und als die Atmosphäre schon klirrend vor Angst war, der Lagerführer immer lauter brüllte, da nützte meine Schwester einen Moment, als der Lagerführer sich ans andere Tischende entfernte, und schlang blitzschnell meine Portion hinunter – ich war überzeugt, dass sie mich vor einem schrecklichen Tod gerettet hatte.
Die Erwachsenen wurden zur Arbeit eingeteilt. Meine Mutter musste zu einer Frau aufräumen gehen. Die ganze Kate war nicht größer als unser Esszimmer zu Hause. Doch die Hausbewohnerin konnte es sich nun leisten, aus dem benachbarten Lager einen Dienstboten anzufordern. Stolz erzählte sie meiner Mutter, die nun ihr armseliges Haus zu putzen hatte, dass ihr Mann Soldat in Jugoslawien sei, und zeigte ihr die "Schätze", die er ihr in wöchentlich einlangenden Paketen schickte: Vorhänge, Bettwäsche, Textilien usw., alles Dinge, die sie sich vor dem Krieg nicht leisten hatte können. Meine Mutter sagte uns: "Und sie schämt sich überhaupt nicht, sie muss doch wissen, dass ich begreife, dass es sich um lauter gestohlene Sachen handelt." Und ich wusste nun, dass uns die "Nemci" deshalb von zu Hause fortgetrieben hatten, weil sie unser Haus, unseren Hof, all die Tiere und alles, was wir in unserem weitläufigen Haus hatten, stehlen wollten, sie schämten sich ja gar nicht und zeigten geraubte Sachen noch voller Stolz her.
Nach drei Monaten kamen wir von diesem (provisorischen) Lager in ein anderes nach Eichstätt in Mittelfranken [4], wo wir bis zur Befreiung blieben.
Der Lagerführer, ein SS-Obersturmbannführer, hatte wiederum gewichste Stiefel und einen Schäferhund. Er hielt so genannte Appelle ab, d.h. alle Lagerinsassen mussten an einem Ort zusammenkommen, er stellte sich auf einen erhöhten Platz – und brüllte, er brüllte, und alle mussten sein Brüllen anhören. Obwohl ich Deutsch nicht verstand, blieb mir der Satz "Ich werde euch alle vergasen lassen" in Erinnerung. Einmal schleppte uns Kinder eine "Rotkreuzschwester" zwei Stunden weit zum Ährenlesen. Die Kleinsten waren vier, die Größten zwölf. Niemals werde ich die Hitze, die Mühsal, die Tränen der Kleinsten, die rüde, kreischende Stimme und das mitleidlose Gesicht dieser "Schwester Agnes" vergessen.
Aus diesem Lager wurde mein Vater bald zur Zwangsarbeit nach Karlsruhe (Rüstungsindustrie) geschickt. Meine Mutter arbeitete zunächst als Hausgehilfin bei einer Frau, deren Mann offenbar eine hohe Stellung hatte. Dann wurde sie zur Erntehilfe zu den Bauern geschickt. Schließlich wurde sie Arbeiterin in einer Schuhfabrik. Sie stand schon immer um drei Uhr früh auf, um uns Kindern heimlich in der Waschküche eine Suppe zu kochen. Ich weiß nicht, wie sie das fertigbrachte.
Immer wieder versuchte ich, die Gespräche der Erwachsenen zu belauschen, und so wusste ich vom Partisanenkampf unter Marschall Tito, er wurde mein Idol, von ihm glaubte ich, dass er sich persönlich um mein Schicksal kümmerte. Umso bitterer empfand ich es, wenn jemand im Lager starb, denn der würde die Freiheit nicht mehr erleben.
Dann kam der Tod auch zu uns. Eine Epidemie brach unter den Kindern aus, der Lagerarzt fand es offenbar nicht schlimm, dass so viele Kinder starben – ich weinte bitter über den Tod meines kleinen Freundes Zvonko. Dann meine Schwester Veronika. Erst viele Jahre später, nach dem Tod meiner Mutter, traf ich eine Augenzeugin, die mir erzählte, wie meine Mutter meine damals achtjährige, kranke Schwester zum Lagerarzt gebracht hatte, dieser gab ihr eine Injektion, und das Kind war auf der Stelle im Arm meiner Mutter tot. Meine Mutter hat uns das nie erzählt, vor allem wollte sie meinen Vater, der bis an sein Lebensende über den Tod dieses Kindes nicht hinweggekommen war, wenigstens in dem Glauben lassen, es sei eines natürlichen Todes gestorben.
Nachdem die Kommunalbehörden der Stadt ein Übergreifen der Epidemie auf die Stadt befürchteten, wurden die restlichen kranken Kinder des Lagers ins städtische Krankenhaus gebracht. So haben wir, meine Brüder, die anderen Lagerkinder und ich, überlebt. Dort hat uns eines Tages meine Mutter besucht, nach Wochen zum ersten Mal sagte eine Krankenschwester, dass die Mutter komme. Ich wollte ihr freudig entgegenlaufen, und als ich sie kommen sah, war sie so anders. Obwohl sie sich freuen sollte, uns wiederzusehen, war kein Lächeln auf ihrem Antlitz, keine Freude in den Augen. Lange, lange richtete sie kein Wort an uns, kein Laut kam von ihren Lippen, bis sie endlich in einer völlig fremden Stimme kaum verständlich sagte: "Veri je umrla." ("Veri ist gestorben.") In diesem Augenblick ist für mich die Welt um mich herum erstarrt. Ich wagte es nicht zu weinen. Dem Tod meiner Schwester, dem Schmerz meiner Mutter konnte ich nichts entgegensetzen. Ich kann es noch heute nicht. Die Fassungslosigkeit vor dem, was ich als Kind dreieinhalb Jahre erleben musste, lebt tagtäglich mit mir weiter.
Die Erstveröffentlichung dieses Artikels in voller Länge erfolgte in: AUFacts Nr. 66, Dezember 1989. Dieser Artikel wurde auch veröffentlicht in: Renate S. Meissner im Auftrag des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus (Hg.): Erinnerungen. Lebensgeschichten von Opfern des Nationalsozialismus, Band 2. Wien, 2012, Seite 66-73.
[1] Im April 1942 wurden in einer Großaktion rund 1.000 Kärntner Sloweninnen und Slowenen "ausgesiedelt" und ins "Altreich" deportiert, wo die meisten von ihnen bis Kriegsende in Lagern leben mussten.
[2] In Ebenthal bei Klagenfurt befand sich eine so genannte Sammelstelle, von der aus die deportierten Familien weitertransportiert wurden.
[3] Dieses "Aussiedlungslager" befand sich in Rehnitz (heute Renice in Polen).
[4] Auch in Eichstätt im heutigen Oberbayern befand sich ein "Aussiedlungslager" für Kärntner Sloweninnen und Slowenen.